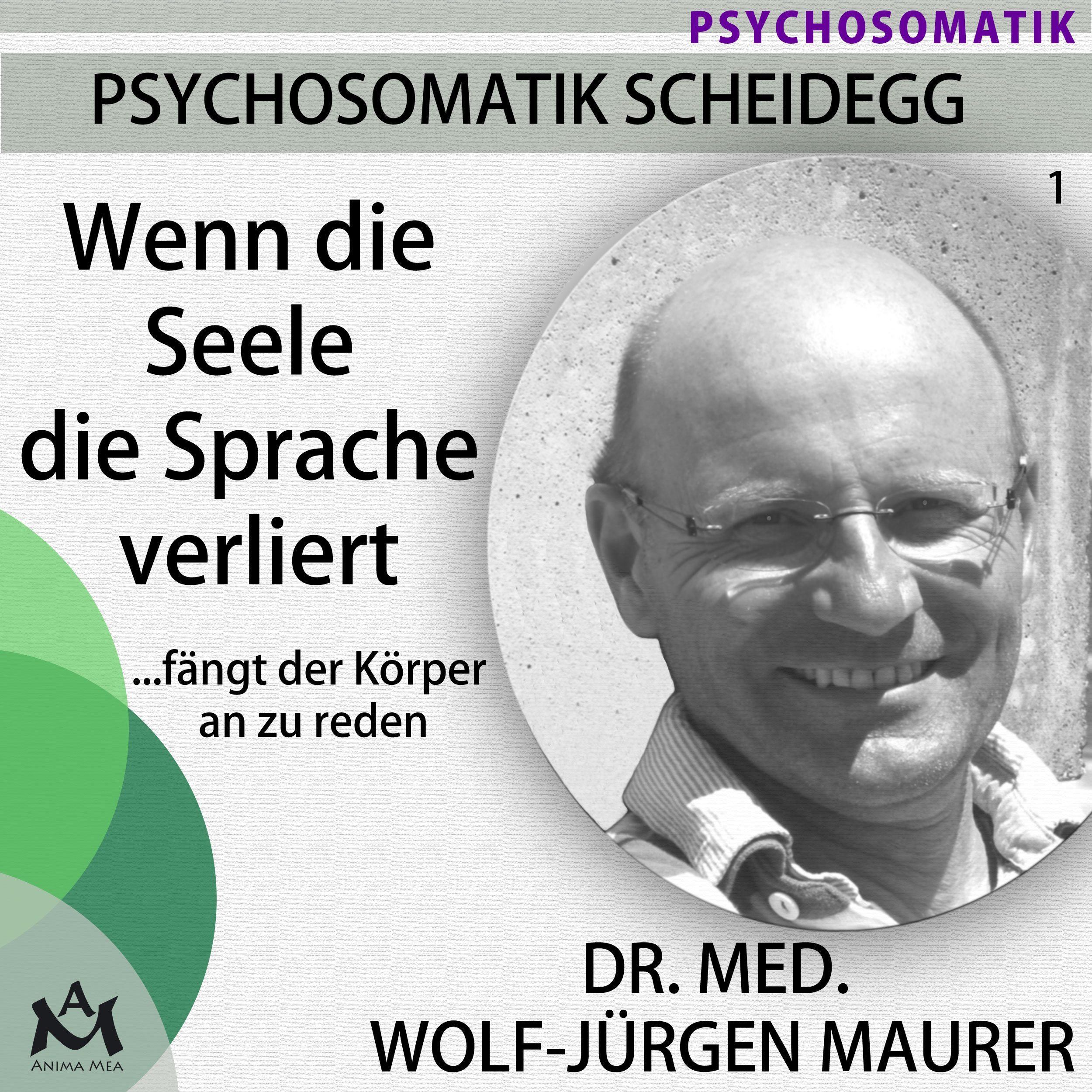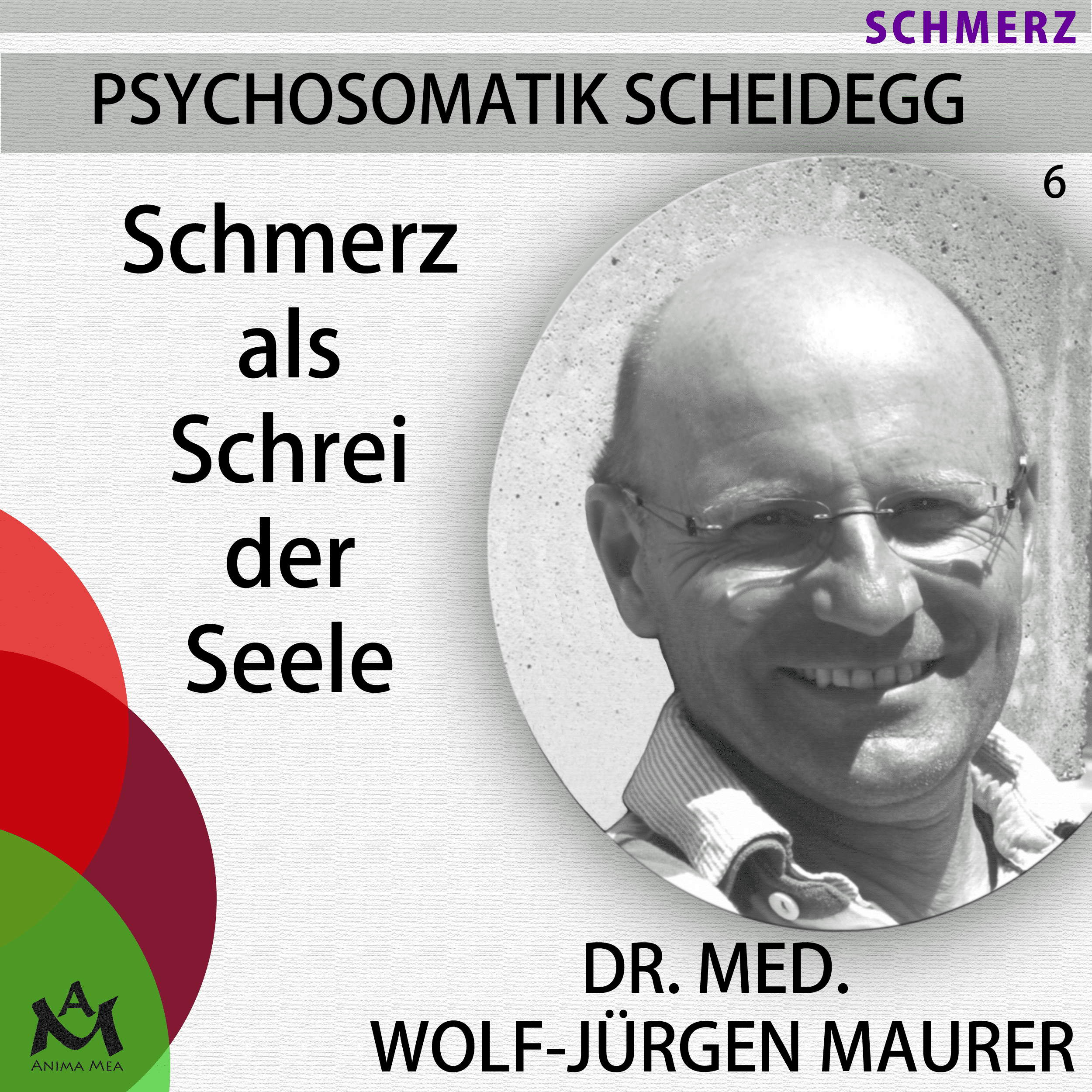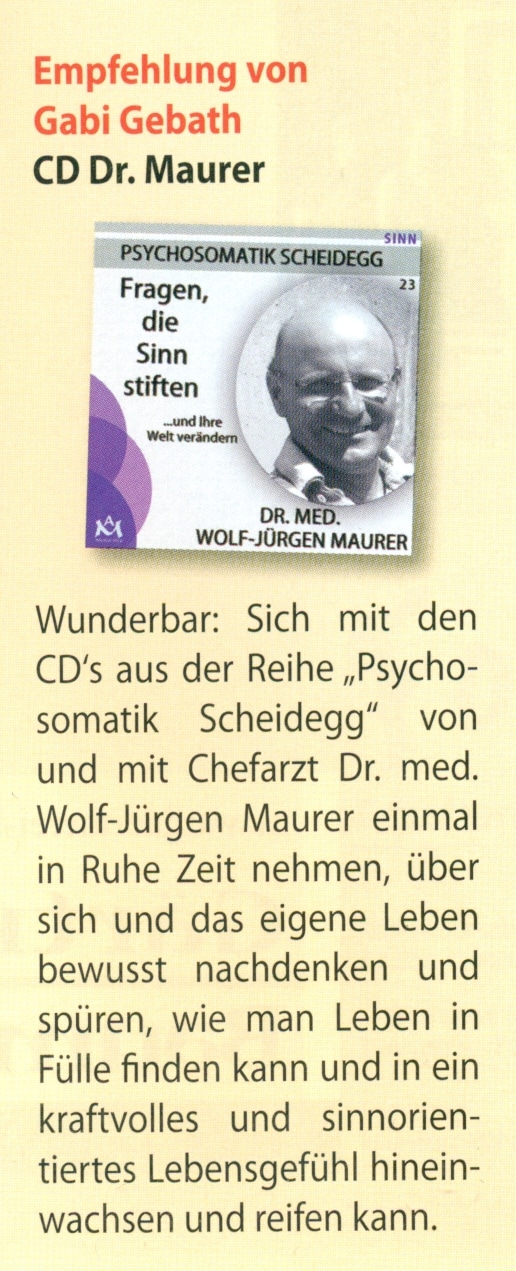S.O.S. des Körpers …
Wenn der Körper
SOS sendet …
Wenn Du krank bist, fehlt Dir was! Was fehlt Dir für eine erfüllende Lebensgestaltung?
Psychosomatik als Beziehungsmedizin:
Was sind somatoforme Störungen und was haben sie mit den Beziehungsmustern der Patienten zu tun?
Wenn Sie mit Beschwerden zum Arzt gehen, der sie durchuntersucht ,befürchten Sie vielleicht oft, dass er etwas Schlimmes oder zumindest Ernstes finden könnte. Findet er aber nichts und sagt der Arzt Ihnen dann gar auch noch wenig einfühlsam: „Sie haben nichts!“ Wie geht es Ihnen dann?
Zum Erstaunen vieler Ärzte sind ihre Patienten dann nicht etwa erleichtert, dass er nichts gefunden hat. Im Gegenteil, einige Patienten sind regelrecht enttäuscht und bekommen noch mehr Ängste und erleben sich entweder vom Arzt nicht ernst genommen oder sogar beschämt, weil er sie ihrer Meinung nach wohl als eingebildeter Kranker einschätzt. Sie fühlen sich hilfloser und ohnmächtiger als „gesunder Kranker“ als vor der Untersuchung.
Und durch diese subjektiv erlebte Zurückweisung erleben sich die Patienten gekränkt, wodurch sich ihre Beschwerdesymptomatik meist sogar noch verstärkt oder bunt wechselnde Beschwerden auftreten. Der Patient klagt dann weiter, obwohl der Arzt nichts findet, die Arzt-Patient-Beziehung verschlechtert sich.
Es kommt zu teuren unsinnigen Wiederholungsuntersuchungen, häufigen Arztwechseln oder Parallelkonsultationen, die Angst der Patienten steigt und steigt und die Beschwerden drohen zu chronifizieren.
Die Lebensumstände des Patienten interessieren in der Praxis den Arzt leider –auch wegen der Zeitknappheit- oft nur wenig, und über Gefühle und emotionale Hintergründe zu sprechen haben sowohl der Patient in seiner Kindheit als auch der Arzt in seiner Ausbildung meist kaum gelernt.
Wenn der zunehmend selbst hilflose und genervte Arzt seinem Patienten dann aber irgendwann lapidar erklärt, er sei nicht organisch krank sondern seine Symptome seien psychisch, und er dafür nicht zuständig, ist dies meist der Punkt, wo es zu einem gereizt-genervten Beziehungsabbruch und gegenseitigem Kränkungserleben kommt und Patienten dann oft jahrelang trotzig darum kämpfen, ja nicht auf die „Psychoschiene“ abgeschoben zu werden.
In naturheilkundlichen Praxen suchen oft Patienten Hilfe, denen die Schulmedizin nicht helfen konnte, weil keine organische Ursache für die Beschwerden gefunden wurden. Manchmal werden Betroffene vorschnell in die „Psychokiste“ gesteckt. Allerdings tritt auch der umgekehrte Fall auf: Psychische Faktoren eines körperlichen Leidens werden verdrängt. Der Naturarzt sprach bereits im Mai 2009 mit Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer über somatoforme Störungen – und darüber, wie Patienten und ihre Partner damit umgehen können.
Herr Dr. Maurer, die Formel „psychosomatisch bedingt“ wird mittlerweile weithin verstanden, beliebt ist sie bei Betroffenen selten. Die Fachleute sprechen in den letzten Jahren eher von „somatoformen Störungen“. Können Sie uns diesen Begriff erläutern?
Leider ist die Erklärung eines Arztes an einen Patienten, dessen Beschwerden seien „psychosomatisch bedingt“, häufig damit verbunden, dass der Patient sich nicht ernst genommen fühlt, Angst hat, vor seinem Arzt als „eingebildeter Kranker“ dazustehen und abgeschoben zu werden. Er fühlt sich beschämt, weil er irrtümlich versteht, dass er „seelisch gestört“ sei. Deshalb ist es wichtig, dass der Arzt seinen Patienten erklärt, dass es andere Einflussfaktoren auf körperliche Missempfindungen oder bei der Schmerzentstehung gibt, als nur die Möglichkeit, dass im Körper etwas „kaputt gegangen“ sein muss. In diesen Fällen spricht man dann besser von einer somatoformen Störung. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die vorhandenen glaubhaften körperlichen Beschwerden „körperliche Krankheiten nachformen“, ohne dass allerdings ein ausreichender Organbefund vorliegt. Der Patient hat also „nicht Nichts“, sondern sein Körper reagiert adäquat, aber nicht auf innere Erkrankungen, sondern auf äußere belastende Einflüsse.
Gibt es bestimmte körperliche Symptome, bei denen man an eine solche Störung denken sollte?
Häufig vorkommende körperliche Beschwerden ohne Organbefund sind z. B. Schmerzen unterschiedlichster und wechselnder Lokalisation von Kopfschmerzen bis Schmerzen in der Brust, Atembeschwerden, Schluckbeschwerden, Kloßgefühle, Übelkeit, Herzklopfen, Bauchgrimmen mit Durchfall, Juckreiz, häufiges Wasserlassen oder Missempfindungen der Haut und der Muskeln, eventuell mit einhergehender Schlafstörung, gedrückter oder reizbar-ängstlicher Stimmung und geringer Frustrationstoleranz. Es gibt allerdings kein einziges typisches Symptom, bei dem man sofort sagen könnte, das ist jetzt allein psychosozial ausgelöst. Geradezu charakteristisch für eine Somatisierungsstörung mit wechselnden körperlichen Beschwerden ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse.
Ist das nicht eine ausweglose Situation für Arzt und Patient: Ein Patient, der in einer solchen Lage nichts von Psychosomatik wissen möchte? Geht da nicht mancher Arzt lieber auf irgendwelche nebensächliche Befunde los?
Es handelt sich um eine Vertrauenskrise zwischen Arzt und Patient oder auch um eine Kommunikationsstörung in der Arzt-Patient-Beziehung. Da braucht es Geduld auf beiden Seiten. Da ist ein Arzt mit viel Verständnis, Wertschätzung und Interesse gefragt, der den Patienten in der Bindung zu ihm halten kann, ihn vor weiteren Schädigungen schützt und mit ihm geduldig ein erweitertes Krankheitsverständnis erarbeitet. Ständig wiederkehrende erneute Untersuchungen bei wechselnden Ärzten (Doktor-Hopping) lassen den Patienten dagegen immer enttäuschter zurück und führen gar zu einer Chronifizierung der Beschwerden durch häufige Selbstbeobachtung. Auch besteht die Gefahr, dass irgendwelche Bagatellbefunde aus Hilflosigkeit sowohl vom Patient als auch Arzt fälschlicherweise für die Wurzel allen Übels gehalten werden und dass diesbezüglich dann „ein schneidende“ Verfahren zum Einsatz kommen – bis hin zur Operation.
Um was geht es bei dem von Ihnen angesprochenen „erweiterten Krankheitsverständnis“?
Zunächst einmal ist klarzustellen, dass die körperlichen Symptome nicht eingebildet sind! Aufregung, Trauer, Enttäuschung, Ärger und Angst können körperliche Symptome hervorrufen. Jedes Gefühl geht mit einer begleitenden Körperreaktion einher. Insbesondere nicht wahrgenommene oder verleugnete negative Gefühle wie Ekel, Wut, Ärger, Trauer, Angst und Furcht sind eindeutig mit körperlichen Reaktionen verbunden. Es gibt eine enge Beziehung zwischen dem Ausdruck der Gefühle und deren physiologischen Begleitreaktionen: Je weniger wir die Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können, desto intensiver ist die begleitende körperliche Reaktion. So entsteht häufig ein Teufelskreislauf, weil körperliche Symptome die Aufregung wieder verstärken können und die Steigerung der Aufregung verstärkt dann wieder die körperlichen Symptome usw.
Was sind typische Auslöser oder Faktoren auf der psychosozialen Ebene? Und müssen Betroffene eine Psychotherapie machen?
Typische psychosoziale Auslöser sind z. B. Belastungen wie Angst, plötzlicher Tod einer nahestehenden Person, Erfahrungen mit körperlicher Krankheit bei Familienangehörigen, Verluste, Kränkungs- oder Zurückweisungserlebnisse – beruflicher oder privater Natur, Zunahme von Verantwortlichkeit und Erwartungsdruck sowie chronische Selbstüberforderung bei angeschlagenem Selbstwertgefühl („nie gut genug“, „Anerkennung über Leistung“). Ängste und depressive Störungen haben häufig als Teilsymptomatik auch Schmerzen zur Folge. Hier gilt es, nicht sofort eine ambulante Psychotherapie zu machen, sondern ein erweitertes ganzheitliches Krankheitsverständnis mit dem Arzt des Vertrauens zu erarbeiten, der einen weiterhin, z. B. mit Naturheilverfahren, körperlich stabilisierend behandeln kann. Es geht nicht primär um Psychotherapie, wohl aber um ein therapeutisches Gespräch. Die Entlastung, die man aus dem Sprechen über seelisch belastende Erlebnisse mit einem verständnisvollen Gegenüber erreichen kann, wird meist unterschätzt!
Gibt es so etwas wie ein psychisches Grundmuster, das die betreffenden Patienten zeigen?
So einfach lässt sich das nicht sagen. Viele Patienten haben aber das Problem, vor Überlastung schützen zu können, möglicherweise aufgrund von fehlendem Selbstbewusstein. Die somatoforme Störung stellt ja im Grunde ein SOS-Signal des Körpers dar: „Sorge besser für mich!“ Gleichzeitig bietet die Störung selbst auch eine Art „Lösung“: Die Annahme der Krankenrolle sichert einem Menschen, der sich selbst nie Ruhe gönnen kann, weil er immer den Erwartungen anderer meint 100-prozentig gerecht werden zu müssen, die einzige Form von Entlastung zu, die ihm derzeit ohne Schuldgefühle möglich erscheint. Viele Menschen mit depressiven, chronisch überfordernden Mustern werden körperlich symptomatisch und haben hierdurch erstmalig die Möglichkeit, „Schwäche“ zu zeigen, ohne sich selbst völlig abwerten zu müssen. Partner oder Familie können durch falsche Rücksichtnahme – oder sogar den unbewussten Wunsch, den Patienten in Abhängigkeit zu halten – die somatische Fixierung und die Chronifizierung der Beschwerden begünstigen.
Wie können Angehörige sensibel und konstruktiv mit dem Betreffenden und seinem Problem umgehen?
Was der kranke Mensch in diesem Moment am meisten braucht ist Solidarität, Loyalität und Mitgefühl und vor allem Interesse und Verständnis, auch für die Bedürfnisse, die für den Partner evtl. hinter den Symptomen „durchschimmern“ mögen. Hier ist auch ein gemeinsames Gespräch von Familienmitgliedern und Partner mit dem Hausarzt häufig hilfreich, zum einen um gemeinsam Sicherheit zu schaffen, dass organmedizinisch nichts verpasst wird, zum andern um zu klären, welche Art von Kommunikation und Beziehungsverhalten bis her eher hilfreich erlebt wurden und welche eher symptomverstärkend wirken. Wichtig ist die gesunden Anteile zu fördern. Zuwendung sollte nicht in verstärkender Weise gerade oder nur dann gegeben werden, wenn der Patient besonders intensiv klagt. Es geht um das gemeinsame Erlernen von Stressbewältigungsstrategien und die Bewältigung von aktuellen Lebenskrisen, um das Vermeiden von negativen Denkmustern und die Vermehrung positiver angenehmer Aktivitäten, also auch um die Steigerung der körperlichen Aktivität, statt um ein Schon- und Vermeidungsverhalten!
Bei manchen Paaren, von denen ein Partner somatoforme Symptome zeigt, hat man den Eindruck, das Symptom „bestimmt“, wie es in der Beziehung läuft. Nun kann man ja dem Betroffenen nicht vorwerfen, dass er das „absichtlich“ macht …
Keinesfalls darf es in der Familie oder in der Partnerschaft zur „Diktatur des Symptoms“ kommen. Unter dem Druck der Symptomatik dürfen niemals wichtige und berechtigte Selbstbedürfnisse des Partners oder anderer Familien mitglieder missachtet werden. Denn ein hierdurch entstehender latenter Groll und die spannungsgeladene Atmosphäre schafft dann eher noch mehr „psychosomatisch Kranke“ in der Familie. Vorwurfsloses, aber klares Begrenzen der Ansprüche des anderen tut hier Not. Keiner kann den anderen alleine durchs Leben tragen, er muss schon wieder lernen, selbst auf eigenen Beinen zu stehen. Der vermehrte Druck in der Familie kann ein wichtiges Zeichen sein, dass Familienberatung oder psychotherapeutische Einzel- oder Paarberatung nötig wären.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht der Patient mit der somatoformen Störung einem Konflikt aus dem Weg, z. B. weil er es nicht schafft, sich vor Überlastung etwa im Beruf zu schützen.
Das ist eine Möglichkeit. Viele Probleme aus dem Berufsleben „schwappen“ in die Paarbeziehung hinein. Der Konflikt kann aber auch in der Beziehung selbst bestehen – weil der Patient alten Verhaltens- und Beziehungsmustern verhaftet ist. Er behandelt seinen Partner so, als fühlte oder handelte dieser wie früher sein Eltern, und ist daher in seiner Beziehungsgestaltung sehr eingeschränkt: Eigene berechtigte Wünsche und Bedürfnisse stoßen auf verinnerlichte elterliche Gebote und Verbote, die dazu führen, dass diese Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse nicht ausgedrückt werden, sondern ängstlich vermieden werden. Über die körperliche Symptomatik kommen dann diese unausgesprochenen Bedürfnisse oder Ängste wieder in die Beziehung hinein. Ein Gespräch zwischen den Beziehungspartner, sinnvollerweise unterstützt durch den Hausarzt oder durch den Paar- oder Familienberater, kann dazu führen, dass auch bisher vermiedene Tabuthemen zwischen den Partnern angesprochen werden, ohne dass es zu Schuldzuweisungen kommt. Über eigene Ängste und Befürchtungen offen sprechen zu lernen und eigene Bedürfnisse nicht mehr ängstlich in sich zu vergraben, kann gelernt werden und ist letztendlich die Bedingung für immer wieder erneute Intimität und eine lebendige und gesunderhaltende Beziehung.
Ich gehe davon aus, dass die große Mehrheit der Betroffenen zumindest heute noch nicht zu einer Paartherapie bereit ist – vielleicht gehört auch das zu den alten Verhaltensmustern. Gibt es für ein Paar eine Chance, aus solch einer verfahrenen Situation, die schon zur Erkrankung eines Partners geführt hat, ohne fremde Hilfe herauszukommen?
Entscheidend ist die Erkenntnis: „Wenn du krank bist, fehlt dir was!“ Die Frage lautet dann nicht, was habe ich denn als Erkrankung, sondern was fehlt mir wirklich für eine erfüllende Lebens- und Beziehungsgestaltung? Wenn beide Partner es schaffen, sich dafür zu öffnen, ohne den andern anzugreifen oder sich angegriffen zu fühlen, sondern versuchen, einander wirklich zu verstehen, sich zuzuhören und gerade über diese langsam bewusst werdenden Wünsche und Ängste zu sprechen – auch wenn nicht jeder Wunsch vom anderen erfüllt werden muss oder darf – wäre sehr viel geholfen! Wenn der Er krankte ein Gefühlstagebuch führt, wo er all seine Ängste, Sorgen, seine inneren Selbstgespräche, seine Wünsche und Befürchtungen aufschreibt und prüft, was er in der Beziehung alles nicht anspricht, kann dies eine erste Hilfestellung sein, sich bewusst zu machen, was durch die Symptomatik unbewusst ausgedrückt wird.
Kann sich ein Paar in guten Zeiten für schwierige Phasen wappnen? Gibt es Warnsignale, bei denen die Alarmglocken schrillen müssten?
In guten Zeiten der Partnerschaft läuft alles wie „geschmiert“. Die Gefahr besteht hierbei, dass erwartet wird, es müsste immer so weitergehen. Konflikte gehören jedoch zu einer guten Partnerschaft dazu. In einer Paarbeziehung geht es um Lebendigkeit und gegenseitige Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung, da muss es immer wieder zu Reibereien, neuen Erklärungen, Verhandlungen und Wechsel zwischen Nähe- und Distanzphasen kommen. Wichtig ist hier, sich den gegenseitigen respektvollen Umgang zu bewahren, auch nicht die Verantwortung für sein Glück an den Partner abzugeben – und immer wieder Gemeinsames und Unterschiedlichkeit auszubalancieren in der Partnerschaft. Regelmäßige, offene, vertrauensvolle Aussprachen, wo es mehr um das gegenseitige Zuhören als das gegenseitige miteinander Reden geht, helfen, sich anbahnende unterschiedliche Bedürfnisse oder Konflikte früh zu erkennen. Ein Warnsignal ist es, wenn sich ein Partner immer weiter zurückzieht, sich abschottet, Blick- und Körperkontakt meidet. „Gedankenleseversuche“ sind dann auch nicht hilfreich, sondern nur die klare Einladung für ein offenes Gespräch. Sobald beide dazu bereit sind, ist eine Lösung prinzipiell möglich. Eine Zweierbeziehung entsteht dann und bleibt bestehen, wenn beide bereit sind, in die Beziehung zu investieren.
Das Gespräch führte Naturarzt-Redakteur Christoph Wagner.
Weiterführende Hörbücher zum Thema:
PSS Band 1, “Wenn die Seele die Sprache verliert, fängt der Körper an zu reden (Wie der Umgang mit Gefühlen krank macht)”
PSS Band 6, “Schmerz als Schrei der Seele”
und
PSS 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 27
 Wird geladen …
Wird geladen …