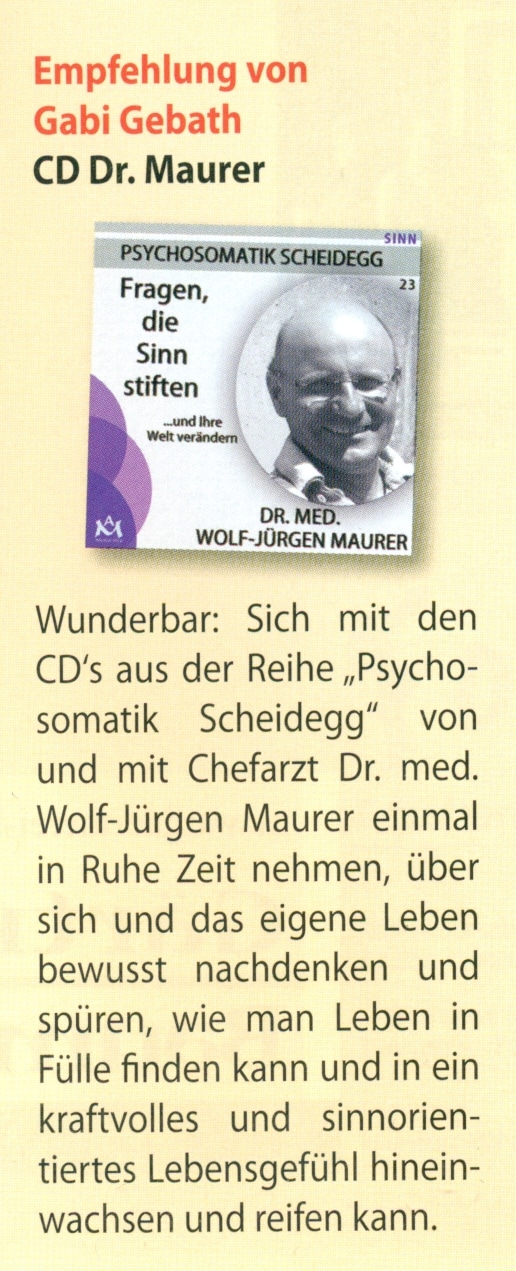Ebbe in der Seele: Depression – der emotionale Infarkt. Depression erkennen und überwinden
von Dr. Wolf-Jürgen Maurer
Depressionen können durch Verlusterlebnisse, chronische Belastungen und soziale Konflikte ausgelöst werden. Zentral ist hierbei die Unfähigkeit zu trauern und ein breites Spektrum an Gefühlen zu erleben oder sich für eigene wichtige Bedürfnisse einzusetzen und sich durchzusetzen.
Depressive Erkrankungen sind vermutlich die häufigsten seelischen Leiden in der Sprechstunde des Hausarztes. Ihre Symptome reichen von körperlich-funktionellen Beschwerden bis zu schwersten, die Lebensqualität sowie die alltäglichen Verrichtungen massiv belastenden psychischen Beeinträchtigungen. Der Betroffene selbst erlebt seine Erkrankung in der Regel als diffuse körperliche Missbefindlichkeit, Folge einer möglichen Organerkrankung oder als Ergebnis eigenen Versagens, seiner Lebensuntüchtigkeit oder Charakterschwäche. Das kann soweit gehen, dass depressiv Erkrankte sich in einer so hoffnungs- und ausweglosen Situation fühlen, dass ihnen der Suizid als einziger Ausweg erscheint. Das Gefühl persönlichen Scheiterns und die Furcht, von den Angehörigen und Mitmenschen als Versager angesehen zu werden, führen dazu, dass depressiv Erkrankte ihren seelischen Zustand schamhaft zu verbergen versuchen. Wenn sie sich hilfesuchend an einen Arzt wenden, tun sie dieses am ehesten, indem sie ihre körperlichen Beschwerden vortragen. Ihre seelischen Nöte offenbaren sie meist nur, wenn sie gezielt danach befragt werden.
Im Laufe des Lebens bekommt jeder Vierte bis Fünfte eine Depression. Derzeit ist jeder Zehnte an einer Depression erkrankt. Allerdings werden nur ein Drittel aller Depressionsfälle vom medizinischen Versorgungssystem diagnostisch erkannt bzw. dann auch professionell behandelt. Selbst nahezu 40 % aller schwergradigen Depressionen sowie 25 % der häufig rezidivierenden Depressionen erhielten noch nie eine depressionsspezifische Behandlung in ihrem Krankheitsverlauf.
Bei Vorliegen mehrerer folgender Symptome wird eine Depression diagnostiziert:
-
Anhaltend (mind. 2 Wochen) depressive niedergeschlagene Grundstimmung
-
Interessenverlust und Freudlosigkeit mit Verlust der affektiven Schwingungsfähigkeit (Gefühl der Gefühllosigkeit-wie versteinert, leer)
-
Vermindertes Selbstwertgefühl, Gefühle der Wertlosigkeit und Scham-, Schuldgefühle mit Selbstvorwürfen
-
Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit/Unruhe/Ängste
-
Gesteigerte Ermüdbarkeit, Erschöpfung, verringerte Kraft und Antrieb
-
Störungen der Konzentration, des Kurzzeitgedächtnisses ,der Denkfähigkeit und der Entscheidungsfähigkeit mit hoher depressiver Ambivalenz
-
Negative Zukunftserwartungen und Sorgengrübeln
-
Sozialer Rückzug und Abkapselung bzw. anklammerndes Verhalten
-
Veränderung von Libido, Appetit und Körpergewicht (Zu-als auch v.a. bei Männern Abnahme ) sowie körperliche Druck-und Verspannungssymptome bzw. Schmerzen
-
Schlafstörungen mit zerhacktem Schlaf und Früherwachen
-
Hoffnungslosigkeit, Gedanken an den Tod als Erlösung
Wir leben in einer Zeit, in der Depressionen wie eine Epidemie um sich greifen. Alles deutet darauf hin, dass nie zuvor ein so großer Teil der Menschheit depressiv war und dass, im Durchschnitt betrachtet, depressive Erkrankungen noch nie so lange anhielten, so gravierend waren und in einem so frühen Lebensalter einsetzten. Seit 1900 ist das Durchschnittsalter, in dem Depressionen ausbrechen, immer weiter gesunken, und immer mehr
Menschen machen im Lauf ihres Lebens eine solche Erkrankung durch.
Nach Einschätzung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sind in Deutschland fünf Prozent der Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren an einer behandlungsbedürftigen Depression erkrankt. Wenn wir die sogenannten
milderen Formen der Depression hinzurechnen, dürfte die Quote bei gut 25 Prozent liegen. Das bedeutet, von den Menschen, die Sie kennen, wird jeder vierte irgendwann in seinem Leben mit einer Depression zu kämpfen haben.
Auf fast neun Prozent der Bevölkerung treffen zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Kriterien für irgendeine Form der Depression zutreffen. Die Zunahme depressiver Erkrankungen lässt sich nicht einfach damit erklären, dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist. Es handelt sich um einen echten Anstieg der Erkrankungszahlen. Laut Schätzungen der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation wird Depression bald die Erkrankung sein, die die meisten Folgekosten verursacht – mehr als Aids, Krebs oder Tuberkulose.
Depressive Erkrankungen werden nicht einfach verschwinden, wenn wir sie zu ignorieren, kleinzureden oder unter den Teppich zu kehren versuchen. Wir müssen sie als ein massives Gesundheitsproblem der Gesamtgesellschaft ernst nehmen. Wir hatten alle schon unsere depressiven Momente, glauben aber, wir müssten uns die Erinnerung daran vom Leib halten. Wir möchten die Depression gern als etwas sehen, das nur anderen zustößt.
Beim Erstgespräch in der psychotherapeutischen Ambulanz gaben nur zwölf Prozent der Personen Depression als ihr Hauptproblem an, doch am Ende wurde bei 45 Prozent von ihnen irgendeine Form von depressiver Störung diagnostiziert. Diese Menschen kamen also in der Regel nicht, weil sie sich als depressiv erlebt hätten, sondern weil die Depression infolge einer Lebenskrise einen bestimmten Punkt erreicht hatte – ob nun durch Probleme in der Ehe, mit
Drogen oder Alkohol oder im Beruf. Wir hatten typischerweise eine Person vor uns, die traurig, erschöpft und resigniert wirkte, nicht schlafen konnte, reizbar und verzweifelt war und sich selbst die Schuld an ihrer Lage gab. Eine Depression entwickelt sich oft so langsam, dass sie weder uns selbst noch uns nahestehenden Menschen bewusst wird, während sie einem außen stehenden Beobachter sogleich auffällt.
Die Begriffe Depression, Kummer und Traurigkeit werden oft durcheinandergeworfen. Das Gegenteil von Depression ist nicht etwa Fröhlichkeit oder Zufriedenheit, sondern Lebendigkeit – die Fähigkeit, das gesamte Spektrum an Emotionen zu erleben, zu denen Fröhlichkeit und Zufriedenheit, aber auch Begeisterung, Traurigkeit und Trauer gehören. Die Depression selbst ist keine Emotion, sondern vielmehr ein Mangel an Emotionen: Eine große schwere Decke hat sich über Sie gelegt, die Sie von der Welt abschirmt, zugleich aber auch in einem quälenden Zustand hält. Das ist keine Traurigkeit und kein Gram, sondern eine Krankheit. Depression ist kein Gefühl, sondern die Unfähigkeit zu fühlen.
Das Hauptmerkmal der Depression ist ein anhaltender Zustand, in dem die Person niedergeschlagen ist oder sich „leer“ fühlt und manchmal auch angespannt und ängstlich ist. Sie hat kaum noch oder gar keine Freude mehr am Leben. Bei einer leichten Depression werden Essen, Sex, Arbeit oder Freizeitaktivitäten zu mechanischen Abläufen, die sich hohl anfühlen; ein schwer Depressiver lässt sich auf all das gar nicht mehr ein, weil er zu müde, zu angespannt oder zu verzweifelt ist. Oft kämpft er mit einer quälenden Erschöpfung, kann sich nicht konzentrieren und hat das Gefühl, dass er nichts Sinnvolles zustande bringen kann. Einen geliebten Menschen oder eine uns wichtige Sache zu verlieren tut weh, doch dieser Kummer oder Schmerz ist etwas anderes als eine Depression, die meistens mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit und Selbstvorwürfen einhergeht. Wir fühlen uns dann ohnmächtig dem Schicksal ausgeliefert – und glauben, dass wir es auch nicht besser verdient hätten. Dagegen bleibt uns bei einer normalen Trauerreaktion meistens bewusst, dass es uns sicher bald wieder besser gehen wird. Und wir sind voller schmerzlichen Gefühle, können aber auf Umgebungsreize noch mitschwingen und sind zumindest kurzfristig auslenkbar. Wir können in der Trauer also unsere Gefühle modulieren, wohingegen ein Depressiver dies nicht kann. Oft schlägt sich die Depression in einer ganzen Reihe von Beschwerden nieder, mit Schlafstörungen als dem Achsen-und Leitsymptom. Manche können schlecht einschlafen oder wachen zu früh auf, ohne sich erholt zu fühlen. Andere schlafen sehr viel, fühlen sich danach aber ebenfalls nicht erholt. Zu wenig Schlaf führt natürlich dazu, dass die Betreffenden irgendwann erschöpft sind, sich emotional zurückziehen und nicht klar denken können – auch dies typische Depressionssymptome. Der Appetit kann gesteigert oder verringert sein, und es kann zu sexuellen Funktionsstörungen kommen. Häufig treten hartnäckige Schmerzen und Missempfindungen auf, die auf ärztliche Maßnahmen nicht ansprechen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie depressiv sind, sollten Sie sich vergewissern, dass keine rein körperliche Störung dahintersteckt, und Ihren Hausarzt um eine entsprechende Kontrolluntersuchung bitten. Wenn Sie dann wissen, dass bei Ihnen eine körperliche Erkrankung vorliegt, sollten Sie aber nicht einfach davon ausgehen, dass die Depressionen gleich verschwinden werden, sobald das körperliche Problem unter Kontrolle ist. Oft sind Suizidgedanken und -impulse im Spiel, und die Suizidgefahr kann sehr real sein. Bei manchen regen sich die Suizidimpulse immer wieder und machen ihnen Angst, während sie bei anderen aus heiterem Himmel einsetzen, aber wie abgekoppelt von ihren Gefühlen wirken. Den Impuls beim Autofahren, das Steuer plötzlich herumzureißen und den Wagen in den entgegenkommenden Verkehr zu lenken, kennen erschreckend viele Menschen, auch wenn keiner darüber redet. Um sich Erleichterung zu verschaffen, greifen Depressive häufig zu Alkohol und anderen Drogen. Das funktioniert aber bestenfalls vorübergehend, und danach ist der Selbsthass meist noch größer, weil sie der Versuchung nachgegeben haben. Alkohol ist im Übrigen im Sinne einer Zweiphasenreaktion ein enthemmendes Mittel einerseits und danach ein Beruhigungsmittel, das bei anhaltendem Missbrauch eine Durch- Schlafstörung sowie eine chronische Depression auslösen kann – und Ihnen jedenfalls nicht hilft, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen, was dann wiederum Anlass gibt, sich mies zu fühlen. Häufig ist es so, dass die Depression nach und nach zu einem Teil der Persönlichkeit geworden ist; in der Erinnerung scheint er schon immer da gewesen zu sein, und die Betroffenen können sich gar keinen anderen psychischen Zustand mehr vorstellen. Die Angehörigen wissen oft nicht, wie sie helfen sollen, wenn Mitgefühl oder moralische Appelle keinerlei Wirkung zeigen. Auf diese Weise geraten Depressive in einen Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Für sie ist die Welt tatsächlich ein schrecklicher Ort, vor allem wenn sie sich mit Selbstvorwürfen quälen und gar nicht erkennen, dass sie krank sind. Von den Menschen mit einer schweren Depression setzen leider 15 Prozent ihrem Leben selbst ein Ende- obwohl ihnen geholfen werden könnte.
Depressive Erkrankungen betreffen also den „ganzen Menschen“ – seinen Körper, sein Fühlen, sein Denken, sein Verhalten. Eine Depression kann uns glauben machen, es sei völlig sinnlos, Hilfe zu suchen. Glücklicherweise lässt sich bei 80 bis 90 Prozent der depressiven Menschen viel ausrichten, doch leider begibt sich nur einer von dreien in Behandlung. Außerdem hält fast die Hälfte der Bevölkerung eine Depression nicht für eine psychische Störung oder Erkrankung, sondern für eine Charakterschwäche. Menschen schämen sich dafür, depressiv zu sein, haben die Vorstellung, sie müssten sich einfach zusammenreißen, und kommen sich schwach und unzulänglich vor. Doch diese Empfindungen sind natürlich Symptome der Krankheit. Die Depression ist eine gravierende und lebensbedrohliche Erkrankung und viel weiter verbreitet, als viele denken. Würden Sie folgende Menschen für schwach oder unzulänglich halten? Hier nur einige berühmte Depressive: Abraham Lincoln, Winston Churchill, Sigmund Freud, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Dustin Hoffman, und viele erfolgreiche Menschen mehr.
Eine Depression ist eine Erkrankung sowohl der Psyche wie auch des Körpers, die in der Gegenwart ebenso wie in der Vergangenheit gründet. In der Psychiatrie und zwischen Psychiatern und Psychotherapeuten sind derzeit heftige Kämpfe zwischen gegnerischen Lagern im Gang: Die einen wollen mit der Behandlung direkt am Gehirn ansetzen, die anderen an der Psyche – und wie es aussieht, besteht zumindest die Gefahr, dass Letztere den Kürzeren ziehen werden, da immer mehr und ohne psychosoziale Behandlungsangebote Medikamente verordnet werden. Es geht hier aber nicht um ein Entweder-oder. Beide Herangehensweisen haben ihre Berechtigung. In den Funktionsabläufen des Gehirns bewirken Psychotherapie und Medikamente ganz ähnliche Veränderungen. Eine Depression ist mit bestimmten biochemischen Prozessen verknüpft, ja, aber die Anfälligkeit für eine Depression, die ein Mensch erkennen lässt, geht auf Erfahrungen zurück, die er in seinem Leben gemacht hat. Eine depressive Phase kann durch ein äußeres Ereignis ausgelöst werden, doch dieses Ereignis setzt dann eine Veränderung in der Funktionsweise des Gehirns in Gang. Eine depressive Phase erlebt ein Betroffener oft so, als habe etwas Fremdes von ihm Besitz ergriffen. Es kommt ihm vor, als sei er nicht mehr er selbst: Etwas Machtvolles ist von außen in ihn eingedrungen und hat ihn
verändert. Andererseits stellen die meisten Menschen, die zum ersten Mal eine Depression erleben, auch fest, dass diese Empfindungen nicht nur fremd, sondern auf eine unheimliche Weise auch vertraut wirken. Sie wissen
noch, dass sie sich als Kinder und Jugendliche oft genauso gefühlt haben – einsam, beschämt und hilflos.
Wenn eine Depression unbehandelt bleibt, kann das für den weiteren Lebensverlauf gravierende Folgen haben: wiederholte depressive Phasen können auftreten mit immer geringeren auslösenden Situationen und Ereignissen oder in eine chronische Verlaufsform übergehen. Bei Männern, die früh (vor dem 22. Lebensjahr) eine schwere Depression entwickeln, im Vergleich zu Männern mit später einsetzender (oder keiner) Depression ist die Wahrscheinlichkeit nur halb so hoch, dass sie heiraten und eine Liebesbeziehung aufbauen werden. Auf lange Sicht scheint eine Depression dazu zu führen, dass Gehirnzellen –reversibel- untergehen und bestimmte Gehirnregionen schrumpfen und zeitweilig deswegen der Zugriff auf vorhandene Kompetenzen erschwert wird. Diese Hirn-Forschungsergebnisse können manche Depressive hoffentlich davor bewahren, sich zu sehr mit Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen zu quälen. Es fällt ihnen dann vielleicht auch leichter, neue Strategien im Umgang mit Stress zu erlernen, die das Risiko künftiger depressiver Phasen erheblich mindern können und sogar zu Neubildung von Hirnzellen und neuronalen Neuverschaltungen führen (lebenslange neuronale Plastizität des Gehirns).
Die Behandlungschance bei Depression ist durchaus gut: Sie lässt sich in der Regel wirkungsvoll und nachhaltig behandeln. Allerdings werden in der hausärztlichen Praxis nur ca. die Hälfte der depressiven Patienten erkannt, davon wiederum nur die Hälfte behandelt und davon wiederum nur ca. die Hälfte ausreichend behandelt.
Eine Depressionstheorie, die nur an einem einzigen Faktor ansetzt, wird meines Erachtens niemals funktionieren. Eine Depression gründet zum Teil in unseren Genen, zum Teil in unseren Kindheitserfahrungen, zum Teil in unserer Art zu denken, zum Teil in Gehirnprozessen, zum Teil in unserem Umgang mit Emotionen. Forschungsergebnisse zeigen, dass unser Gehirn Erfahrungen nicht nur abspeichert. Vielmehr verändert jede Erfahrung das Gehirn in seiner Struktur und in elektrischen und chemischen Abläufen. Die Erfahrung wird zu
einem Teil des Gehirns. Wenn wir also darauf achten, welche Erfahrungen wir unser Gehirn machen lassen, können wir es gezielt verändern. Die neuere Hirnforschung hält eine wichtige Botschaft für uns bereit: Üben ist eine wesentliche Voraussetzung für Veränderung. Das Üben lässt Verknüpfungen zwischen Gehirnzellen entstehen, die bislang nicht miteinander vernetzt waren.
Die Netzwerke in unserem Gehirn, die depressives Verhalten stützen, sind wie viel befahrene Autobahnen. Wir müssen sozusagen von der Autobahn abfahren und uns neue Wege suchen. Durch Übung wird das Befahren der neuen Straßen zur Gewohnheit, weil sich in unserem Gehirn neue Verschaltungen bilden.
Um eine Depression überwinden zu können, brauchen wir ein neues Repertoire von Strategien, dazu gehört die Verbesserung emotionaler Intelligenz und das erfolgreiche Gestalten zwischenmenschlicher Beziehungen. Depressive verändern sich allerdings durch ihre Erkrankung: Im vergeblichen Bemühen, Schmerz und Leid zu ersparen, entwickeln sie bestimmte Strategien wie zum Beispiel: Wut hinunterschlucken, sich zurückzuziehen, sich abzukapseln, zuerst an andere denken und sich dafür verantwortlich fühlen, die Probleme anderer zu lösen. Auf diese Weise sabotieren sie die eigene Genesung. Sie müssen sich von diesen depressiven Gewohnheiten lösen, die sie verwundbar für Rückfälle machen. Durch die Depression verändern sich zentrale Aspekte der Persönlichkeit – Fühlen, Denken, Verhalten, Beziehungen, Umgang mit dem Körper und mit Stress – , weil sich bestimmte Gewohnheiten einspielen, die sich mit der Zeit so anfühlen, als wären sie ein selbstverständlicher Teil des Betroffenen. Sie merken nicht, dass diese Gewohnheiten die Depression in Gang halten und verstärken. Sie müssen sie bewusst fokussieren und mühsam verlernen und durch neue ersetzen lernen. Betroffene lernen in einer Therapie, die ich oft als Beziehungs-Fitness-Trainingslager bezeichne, wie sie auf eine neue Weise denken, handeln, fühlen und zu anderen in Beziehung treten können, um alte Muster zu ersetzen, die noch nie funktioniert und ihre Situation oft noch verschlimmert haben. Menschen kommen vor allem deswegen von ihren depressiven Gewohnheitsmustern des Denkens, Fühlens und selbst- sabotierenden Verhaltens nicht los, weil sie nicht wissen, was sie anders machen sollen, denn diese ganzen depressiven Verhaltensmuster haben sich ins Gehirn eingebrannt und oft sind Betroffene alleine nicht in der Lage sind, sich überhaupt Alternativen vorzustellen. Die depressiven Strategien sind im Wesentlichen Verschaltungen im Nervensystem. Wenn die Betroffenen sich von ihren Angewohnheiten lösen, verkümmern die alten Verschaltungen und werden durch neue Verbindungen ersetzt, die sich durch ihr verändertes Verhalten herausbilden. Durch fokussierte Aufmerksamkeit und durch Üben können wir Menschen unser Gehirn verändern. Es ist deshalb umso dringender geboten, depressive Menschen zu ermutigen und dazu zu befähigen, auf eine Weise aktiv zu werden, die ihnen wirklich Schritt für Schritt weiterhilft. In uns sind allerdings auch unbewusste Kräfte am Werk, vor allem Ängste und Vermeidungsstrategien, die einer positiven Veränderung im Weg stehen. Eigentlich lernen Menschen durch Erfahrung und wachsen an ihr, doch aus Angst meiden depressive Menschen Erfahrungen, die ihnen weiterhelfen würden. Es geht deshalb meiner Erfahrung nach darum, Alternativen zu depressivem Verhalten zu lernen, indem Betroffene diese Alternativen einüben und einschüchternde Aufgaben in kleinen Schritten angehen. Sobald dann der Anteil der nichtdepressiven Verhaltensweisen groß genug ist, erleben die Betroffenen sich als selbstwirksam, entwickeln Hoffnung und Selbstvertrauen, können ihre Bedürfnisse in Beziehungen besser befriedigen und sind dann auch nicht mehr depressiv.
Bei vielen Depressiven haben Traumata oder Entbehrungs- und Trennungs- oder
Verlusterlebnisse in der Kindheit den Weg in die Erkrankung vorgezeichnet. Von Schwierigkeiten in der Kindheit oder im späteren Leben, die ihr Selbstwertgefühl und ihre Lebensfreude geschwächt und ihre Sensibilität für Zurückweisungen und ihre Selbstzweifel verstärkt haben, berichten die meisten Depressiven.
Medikamente sind oft hilfreich, weil die Depression zweifellos auch eine biochemische Komponente hat, reichen aber für die Behandlung in den meisten Fällen nicht aus. Ob die Wurzeln einer Depression nun in der Kindheit liegen oder sie von aktuellen schwierigen und konfliktreichen sozialen Situationen ausgelöst wird, die durch kumulierende Stresserfahrung biochemische Prozesse im Gehirn zur Folge haben: eine Genesung ist nur durch beharrliche Willensanstrengung im Hier und Jetzt mit korrigierenden neuen Erfahrungen im Umgang mit Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen möglich. Das ist die unbequeme Wahrheit. Depressive müssen also neue Wege finden, wie sie mit sich selbst und mit anderen leben können.
Für alle Betroffenen besteht Hoffnung auf Besserung durch Psychotherapie und Medikamente. Selbst Menschen, deren Leben völlig von der Depression bestimmt ist, haben eine Chance auf ein erfülltes Leben, wenn sie bereit
sind, Techniken der Selbststeuerung zu erlernen, eigene Gefühle und Bedürfnisse differenzierter wahrzunehmen üben, sich neue Kommunikationsstrategien aneignen und das eigene Selbst- und Weltbild auf den Prüfstand stellen. Zumindest bei mittel- bis schwergradigen Depressionen sind sich die meisten Experten darin einig, dass eine kombinierte Behandlung mit Medikamenten und Psychotherapie am besten wirkt, keinesfalls sollte aber eine Tablette eine psychosoziale Unterstützung und -bei anhaltender Depressivität und depressiven Mustern- Psychotherapie ersetzen. Leider wurde in den letzten 2 Jahrzehnten Depression zunehmend als ein biochemisch zu korrigierendes Leiden definiert, und viele Forscher und Psychiater meinten, eine Prüfung der Stressfaktoren im Leben der Einzelnen erübrigte sich.
Dann begann sich herauszustellen, dass Medikamente gar nicht so wirkungsvoll waren, wie angenommen. Es zeigte sich also, dass eine Depression sich nicht einfach auf ein biochemisches Ungleichgewicht im Gehirn reduzieren lässt.
Die Entstehung von Depressionen wird begünstigt durch die Tendenz, den Erwartungen der sozialen Umgebung gerecht werden zu müssen. „Unpassende Emotionen“ werden unterdrückt, eigene Bedürfnisse zurückgestellt. Häufig liegen frühe Erfahrungen von Hilflosigkeit, Verlust oder Vernachlässigung zugrunde. In der Kindheit wurden die Betreffenden über Schuldgefühle oder Drohung, die Beziehung abzubrechen, gefügig gemacht. Dies erklärt die Bereitschaft depressiver Patienten, die eigenen Interessen zu vernachlässigen, um die Beziehung zu anderen nicht zu gefährden.
Vorstufe einer depressiven Entwicklung ist das sogenannten Burnoutsyndrom als Stressfolgeerkrankung, das mannigfaltige Symptome von Schlafstörungen, Infektanfälligkeit, körperlichen Funktionsstörungen, Schmerzen über Ängste bis hin zu einer schweren Erschöpfungsdepression zeigen kann, die sich in der Endstrecke in nichts von einer depressiven Störung unterscheidet- wobei die Betroffenen oft auch dieselben depressiogenen früh gelernten Abwehr-und Überlebensstrategien und selbstzerstörerischen Gewohnheitsmuster aufweisen.
Sind sie unzufrieden mit Ihrem Leben? Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt, müde, körperlich und/oder psychisch erschöpft? Wachen Sie nachts mit grübelnden Gedanken auf und fühlen sich tagsüber zerschlagen? Sind Sie häufiger erkältet und krank oder haben Sie häufig Rücken-, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle oder Magenschmerzen? Denken Sie häufig zunehmend negativ oder zynisch über sich selbst, Ihre Mitmenschen oder Ihre ganze Arbeit und quält Sie zunehmend ein Gefühl von Ineffektivität und Sinnlosigkeit? Können Sie auch in der Freizeit kaum noch entspannen und erleben viel zu selten erfüllende Sexualität und Zärtlichkeit? Ziehen Sie sich immer mehr von anderen Menschen zurück, haben oft Angst und gereizte Stimmung und finden es oft traurig, dass so wenig Anerkennung für das Geleistete zurückkommt? Trinken Sie zu viel Alkohol, rauchen und essen Sie zu viel?
Dann leiden Sie wahrscheinlich unter dem Zustand, den wir als „Burn-Out“ nennen!
Burn-out ist ein Prozess des Ausbrennens. Dieser Begriff wurde von dem amerikanischen Psychoanalytiker H. J. Freudenberger geprägt, für eine Krankheit bei der Idealismus, Arbeitseifer und Begeisterung schwinden und zeitgleich körperliche Beschwerden auftreten (Dauermüdigkeit, Magenschmerzen, Schlafstörungen). Burn-Out trifft vor allem Menschen in helfenden Berufen, die mit besonders hohem Anspruch ins Berufsleben gestartet sind, aber auch Menschen denen die berufliche Anerkennung versagt bleibt oder die ihren Karrierehöhepunkt überschritten haben. Immer sind Menschen mit hohen eigenen Ansprüchen und Selbstüberforderungstendenzen betroffen, Menschen die viel Engagement in ihre Tätigkeit investieren. Besonders häufig betroffen sind Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte und Krankenschwestern; aber auch selbständige Jungunternehmer, Frauen mit häufigen Doppelbelastungen und pflegende Angehörige von chronisch körperlichen oder psychisch kranken Menschen sind Burnout gefährdet.
Burnout-Patienten haben sich im Unterschied zu depressiven Patienten oft bereits früh als selbstwirksam erfahren, wurden aber meist nur bestätigt, wenn sie besondere Leistungen erbrachten. In der Kindheit wurden sie oft in nicht kindgerechte, überfordernde Rollen gedrängt, so dass sie später ihre Selbstwertgefühle nur über Anerkennung und Leistung erhalten. Dies lässt sie nie zur Ruhe kommen. Sie können nur schlecht delegieren oder sich abgrenzen, so dass sie mit unerbittlichen Ansprüchen an sich und andere, sich selbst im Funktionsmodus verlieren.
Depressionen und ein Burnout-Syndrom können als eine Reaktion des Unbewussten auf ein Ungleichgewicht in der inneren Bilanz gesehen werden. Das Unbewusste weigert sich, weitere emotionale Minusgeschäfte zu machen. Die Krankheiten schützen also vor sinnlosen Anstrengungen und zwingen den Betreffenden in den Energiesparmodus, um Selbst- und Fremdausbeutung zu stoppen. So bekommt die Krankheit eine Signalfunktion mit der Botschaft, dass Veränderungen anstehen und der Patient nicht weiter mit dem bewussten Verstand gegen das Symptom, also gegen sich selbst, ankämpfen sollte.
Die Symptome fordern dazu auf, sich selbst wieder mehr Raum zu geben, berechtigte Bedürfnisse und Interessen offener zu vertreten, hilflose Opferrollen, die von kindlichen Grundüberzeugungen gespeist sind, zu verlassen, und als selbstwirksamer Gestalter eigenen Lebens die Lebenszügel wieder in die Hand zu nehmen.
Selbstwertprobleme und eine mangelnde Selbstachtung sind also zentrale Themen bei Patienten mit Depressionen oder Burnout. Es mangelt an Erfahrungen, dass das eigene Handeln einen entscheidenden Einfluss auf die eigenen Emotionen hat und dass man selbst seine Gefühlswelt steuern kann, denn das ist ein wichtiger Grund für die Hoffnungs- und Hilflosigkeit, die der Patient in Bezug auf seine Lebensgestaltung zeigt.
Der entscheidende Aspekt einer therapeutischen Veränderung besteht in der konkreten emotionalen Erfahrung, dass man sich tatsächlich anders fühlen kann, wenn man sein Leben anders gestaltet, und dass die eigenen depressiven Stimmungen nicht eine Reaktion auf die Welt und das Verhalten Anderer sind. Die Erkenntnis, dass die beklagten Gefühle wie Wut, Ärger, Enttäuschung, Niedergeschlagenheit, Scham, Depression und das Gefühl, ausgebrannt zu sein, in Beziehung zu eigenen Mustern und Verhaltensweisen stehen, geben Impulse zur Veränderung. Solche Gefühle sind oft Reaktionen auf die selbstgeschaffenen Erfahrungen, die geprägt sind von Entscheidungen gegen die eigene Person. Es gilt also, wieder zu lernen, selbstbestimmt zu leben, denn niemand wird geboren, um die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Depressionsvermindernde Teilziele einer solchen Behandlung sind:
- Wieder aktiv werden, um wieder positive Erfahrungen machen zu können. Ziel hierbei ist, die Verstärkung angenehmer Erfahrungen und der Abbau belastender Erfahrungen und depressiogenem Vermeidungsverhalten bzw. Rückzugs aus Beziehungen. Vor allem regelmässiges moderates Ausdauertraining wirkt antidepressiv. Hilfreich ist die genaue Planung mit Hilfe eines Aktivitätenplans. Depressive Menschen lassen sich zu sehr von Pflichtaktivitäten davon abhalten, Dinge zu tun, die mittelfristig ihre Stimmung verbessern. Über das Führen eines Depressions-Tagebuches (hierbei wird die Veränderung der Stimmung im Zusammenhang mit unterschiedlichen Situationen, eigenen Aktivitäten und Gedanken notiert im Sinne einer Selbstbeobachtung) können ursächliche oder aufrechterhaltende Bedingungen für die depressive Verstimmung erkannt werden. Anschließend ist ein Veränderungstagebuch mit Anleitung zu Tagesstrukturierung und Aktivitätenaufbau hilfreich.
- Wieder in Kontakt zu Menschen treten, um wieder positiven Gefühlsaustausch erleben zu können. Ein Schlüsselsymptom der Depression ist der soziale Rückzug, das Verkriechen (Teufelskreislauf von Depression und Rückzug!). So sehr man sich am Anfang auch überwinden muss, es ist äußerst wichtig, alte Kontakte und Beziehungen zu erneuern. Falls der Umgang mit Menschen noch nie kompetent erlernt wurde, ist die Schulung sozialer Wahrnehmung mit Training von sozialen Fertigkeiten und Kommunikationsübungen wichtig.
- Wieder einen guten Umgang mit sich selbst lernen und hierbei von der Selbstbestrafung zur Selbstbestätigung zu finden. Überhöhte Leistungsnormen und unrealistische Erwartungshaltungen an sich selbst sind zu überprüfen, und hilfreich ist es zu lernen, sich selbst zu belohnen für das Erreichen kleiner Zwischenziele. Auf positives Fokussieren (Freude-und Dankbarkeitstagebuch!) und auf Erreichtes und eigene Talente stolz sein dürfen. Auch ein Genuss-und Kreativtraining (Singen, Tanzen, Malen)sowie Entspannungstraining kann hilfreich sein.
Rückfallverhindernde Teilziele einer Therapie:
- Denkmuster und Einstellungen überprüfen und verändern, so dass sie ein lebenswertes Leben zulassen. Depressive Gedanken sind ein Symptom der Erkrankung. Sie verzerren die Sichtweise über sich selbst und die Welt in den schwärzesten Farben. Es ist wichtig, diese Gedanken nicht als wahrheitsgemäße Abbildung der Welt zu sehen. Es handelt sich hier um negativ verzerrte Gedanken, wobei es mehrere typische depressive Denkweisen und gedankliche ‘Fehler’ gibt:
So z.B. die Neigung zu Verallgemeinerung und zum Übertreiben, weiterhin die Einseitigkeit der Denkweise mit Ignorieren aller positiver Dinge sowie die eigene Negativetikettierung und das Gedankenlesen mit falschen und katastrophisierenden Vorhersagen und Schwarz-Weiß-Denken i.S. eines Alles-oder-Nichts-Denkens. Depressive Gedanken aber machen depressive Gefühle und man kann somit in einen depressiven Strudel geraten. Es ist notwendig, sich nicht diesen depressiven Gedanken zu überlassen. Hilfreich kann es sein, schriftlich realistische Gedanken zu sammeln, die depressiven Gedanken zu überprüfen und die realistischen Gedanken immer wieder durchzulesen. Oft kann man hierbei die depressiv machende Überlebensregel des abhängig-selbstunsicheren/leistungsorientiert-perfektionistisch organisierten Menschen entdecken. Ganz wichtig ist hier auch ein stressreduzierendes Achtsamkeitstraining, wo die Gegenwartsorientierung durch Aufmerksamkeitsschulung geübt wird. - Bisher verbotene Gefühle wieder wahrnehmen und ausdrücken lernen, wie Trauer und Wut, d.h. also auch vermiedene Trauerprozesse nachholen. Die Aufgabe lautet nichts zu tun, wozu depressive Gefühle den Patienten bringen wollen. Entscheidend ist, statt Vermeidung das zu tun, was anfänglich noch Angst macht, z.B. unter Menschen gehen. Statt aus Hilflosigkeit entstandene Passivität positive angenehme Aktivitäten planen und durchführen. Statt angestrengter Pflichterfüllung ‘egoistischer’ mit den eigenen Bedürfnissen umgehen und sich selbst fürsorglicher zu behandeln. In der Regel sind bei depressiven Patienten all diejenigen Gefühle verboten, die selbstbezogen sind, den eigenen Bedürfnissen und Interessen Geltung verschaffen würden. Es ist wichtig, sich auch die verbotenen Gefühle zu erlauben und die Verantwortung für diese Gefühle zu übernehmen.
- Zwischenmenschliche Beziehungen neu gestalten lernen, so dass Beziehungs- und Selbstbedürfnisse darin Platz haben. Hier ist es wichtig zu lernen, dass man als Erwachsener erst überleben kann, wenn man gegen die kindlichen Denk- und Verhaltensweisen verstößt. Es ist wichtig, in die Angst hineinzugehen und neue Verhaltensexperimente zu wagen, um vor allem die eigenen Unabhängigkeitsbedürfnisse zu befriedigen. Erst dann kann man sich selbst als allein lebensfähiges Wesen erfahren. Depressive Menschen müssen lernen, gut für sich selbst und ihre Bedürfnisse zu sorgen und sich mit einem Freundeskreis zu umgehen, die ihn nicht nur akzeptieren, wenn er sich wie üblich ausnutzen lässt. Erst dann kann man die Erfahrung machen, dass andere Menschen einen um so mehr schätzen und attraktiver finden, je mehr man die eigene Identität entwickelt, für sich selbst sorgen kann und somit fähig ist, zu einer erwachsenen Beziehungsgestaltung mit einem gleichberechtigten Austausch von Geben und Nehmen.
Hier kann ein Selbstsicherheits- bzw. ein soziales Kompetenztraining helfen.
Die allgemeine Lebensgestaltung sollte so verändert werden, dass wesentliche positive Erfahrungen von verschiedenen Quellen kommen, um unabhängiger von einer einzigen wichtigen Bezugsperson oder der bisher einzigen Bezugsquelle (Beruf oder Kinder) zu werden.
Entscheidend ist also, die häufig anfänglich unverständliche Depression in einen interpersonellen Kontext zu stellen, die häufig durch zwischenmenschliche Konflikte ausgelöst wird. In zwischenmenschlichen Beziehungen kann eine Depression die Funktion bekommen, sich abzugrenzen, wenn man nicht nein sagen kann, die Kontrolle zu übernehmen, wenn man sich dazu offen nicht traut. Weiterhin besteht durch eine depressive Symptomatik die Möglichkeit, sich Schwäche zu erlauben, die man sonst nicht zeigen darf, Zuwendung und Schonung zu bekommen und Entlastung von Pflichten, was man sich sonst selbst nicht erlauben könnte.
Deshalb ist die Betrachtung der zwischenmenschlichen Bezüge, der eigenen Verhaltensmuster und der Kommunikationsfähigkeiten sehr wichtig für die Therapie. Ggf. ist auch an eine Paartherapie zu denken.
Wenn ein Verlust endgültig ist, kann Verhaltenstherapie dem Patienten helfen, den Verlust dadurch zu verkraften, dass er durch eigene Aktivitäten Zugang zu anderen Verstärkungen erhält, dass er so seine gelernte Hilflosigkeit angesichts des scheinbar nicht zu verkraftenden Verlustes wieder verlernt.
Oft gilt es hier, flexiblere Verhaltensstrategien auch im Rollenspiel zu üben und zu lernen, neue Prioritäten im Leben zu setzen. Häufig ist eine Einstellungsveränderung die einzige Möglichkeit. Statt immer nur auf das zu starren, was nicht funktioniert, was einem fehlt, wieder auf das zu achten, was gut läuft und was ich als Positiva in meinem Leben erreicht habe. Statt einer depressiven Verarbeitung (‘schlimm, daß ich ihn verloren habe’), gilt es neue Verarbeitungsmuster zu erlernen (‘schön, daß ich ihn gehabt habe’).
Schließlich ist noch auf eine Rückfallprophylaxe zu achten mit Vorbereitung auf mögliche Krisen durch Spielen schwieriger Situationen im Rollenspiel und Alltagserprobung.
So gesehen kann eine depressive Erkrankung auch als Chance angesehen werden, die eigene problematische und einengende Lebens- und Beziehungsgestaltung zu überprüfen und das eigene Lebensarrangement besser auf eigene Bedürfnisse abzustimmen. So kann eine depressive Störung auch einen ‘Sinn machen’, wenn sie im eigenen Lebenszusammenhang und im Kontext von sozialen Konflikten, Enttäuschungen und Verlusten gesehen werden kann. Dann kann das Lamentieren abgelöst werden durch die Suche nach neuen Lösungen, neuen heilsamen Ritualen und Einüben neuer Gewohnheitsmuster des Denkens, Fühlens und Verhaltens in Beziehungen.
Depressionen sind gut behandelbar, besonders wenn sie frühzeitig erkannt und adäquat therapiert werden.
Für an stationärer Behandlung Interessierte, Ärzte und Therapeuten abschliessend noch ein Hinweis zu stationären Behandlungsmöglichkeiten am Beispiel der Panorama-Fachkliniken in Scheidegg im Allgäu:
In den Panorama Fachkliniken werden sämtliche depressive Störungen, allerdings nur sofern keine psychotischen Symptome vorliegen, behandelt:
-
Depressive Episoden, jeglichen Schweregrades, akut und rezidivierend,
-
depressive Anpassungsstörungen,
-
anhaltende affektive Störungen im Sinne einer chronischen Depression,
-
Double-Depression (schwere Dysthymia mit depressiven rez. Episoden),
-
schwere Erschöpfungsdepressionen mit depressiven Somatisierungen.
Ausgeschlossen für das Setting der Panorama Fachklinik sind bipolare affektive Störungen und depressive Störungen mit psychotischen Symptomen sowie das Vorliegen einer akuten Suizidalität ohne ausreichende Steuerbarkeit.
Aufnahme in die Panorama Fachklinik finden Patienten mit depressiven Störungen vor allem, wenn diese entweder mittel bis schwergradig oder chronifiziert sind mit entsprechenden Einschränkungen der Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben mit einhergehendem ausgeprägtem sozialem Rückzugsverhalten, schwerer Antriebslosigkeit oder ängstlichem Vermeidungsverhalten, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen, ausgeprägten Erschöpfungssymptomen mit körperlichen Symptomen und Schlafstörungen. Ebenso bei einhergehender Komorbidität mit z. B. Angststörungen, persönlichkeits-strukturellen Defiziten und ausgeprägten Defiziten der Patienten im Bereich der sozialen Kompetenz und der Emotionsregulationsfähigkeit, sodass sie im interpersonellen Raum Übungsmöglichkeiten brauchen, um diese Kompetenzen zu erwerben.
Ausserdem Patienten, die nach ambulant-therapeutischer und psychiatrischer Vorbehandlung nicht ausreichend auf die Behandlung ansprachen und sowohl einer intensiven kognitiv-verhaltenstherapeutischen oder interpersonellen bzw. konfliktzentrierten Bearbeitung der Auslöse- und aufrechterhaltenden Faktoren bedürfen, als auch Kombination mit einer psychopharmakologischen Behandlung und einem Halt gebenden und entlastenden Setting.
Ebenso Patienten mit latenter Suizidalität bei allerdings noch erhaltener Steuerungsfähigkeit oder wenn die Etablierung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung ambulant bisher nicht ausreichend gelang und die Patienten eine intensiven multimethodalen psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung bedürfen. Insbesondere Patienten mit Teilhabestörungen wegen Chronifizierungstendenz der Depression, Belastungs- und Arbeitsunfähigkeit mit Leistungsinsuffizienz, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen auf dem Hintergrund interpersoneller Konflikte und sozialer Kompetenzdefizite sowie Patienten mit persönlichkeitsstrukturellen Einschränkungen der Emotions- und Beziehungsregulationsfähigkeit mit wiederkehrenden Beziehungskonflikten und Beziehungsabbrüchen und Vereinsamungstendenz brauchen das haltende stationäre Setting mit dem Prinzip der therapeutischen Gemeinschaft, um neue korrigierende Erfahrungen zu machen und alte Schemamuster zu verändern, um ihnen so wieder die Teilhabe am gesellschaftlich-beruflichen Leben zu ermöglichen und sowohl sich als auch ihre Beziehungen besser regulieren zu lernen, ohne depressiv oder somatisierend zu dekompensieren.
Bezüglich der Teilhabe können die bei uns behandelten depressiven Patienten ihre Belastungsgrenzen in privaten oder beruflichen Beziehungen selbst schlecht wahrnehmen und noch schlechter schützen, bei meist vorliegenden überhöhten Selbstansprüchen mit perfektionistischen Tendenzen, hoher Selbstkritik mit Defiziten der Konflikt- und Abgrenzungsfähigkeit und mangelnder Fähigkeit für Selbstfürsorge bei zugrunde liegenden depressiven Grundkonflikten (früh erlebte Beziehungsverluste und -enttäuschungen) mit einhergehender hoher Sensitivität für Verlust und Trennungssituationen und unsicherem Bindungsstil, die häufig Auslöser für die depressive oder depressiv-somatisierende Dekompensation sind, ebenso wie Kränkungs- und Konflikterlebnisse oder zunehmende soziale Vereinsamung bei abhängiger oder vermeidender Beziehungsgestaltung und Unterdrückung von berechtigten Autonomiebedürfnissen mit Rückzug aus nahen Beziehungen.
Unser intensives stationäres Behandlungssetting ist multimodal angelegt nach einem integrativen Gesamtkonzept.
Es wird am besten umrissen als ressourcenaktiviernde psychodynamisch-interaktionell fundierte und verhaltenstherapeutisch optimierte lösungsorientierte Psychotherapie.
Nach dem Motto: Psychodynamisch Verstehen – systemisch Denken – lösungsorientiert und übend Intervenieren.
Es ist als Kurzzeittherapiesetting angelegt mit Schwerpunkt der Arbeit im Hier und Jetzt, Gegenwarts- und Lösungsorientierung zur Verbesserung von Bewältigungsfertigkeiten, Funktionsfähigkeit und sozialer Teilhabe unserer Patienten. Die Entwicklungsorientierung und nicht die Störungsorientierung steht hierbei im Vordergrund. Es wird regressionsbegrenzend und progressionsorientiert gearbeitet.
Die verschiedenen multimethodalen Therapiebausteine werden nach einem individuellen Fallkonzept auf jeden Patienten zugeschnitten und zusammengestellt, je nach Persönlichkeitsstruktur, Vorerfahrungen und aktueller Passung und Wünschen/Zielen der Patienten.
Hierbei wird ein Schwerpunkt gelegt auf die bindungsbasierte, vertrauensvoll wertschätzende Beziehungsgestaltung zwischen Patient und Therapeut mit der Möglichkeit, falls es hier nicht zu einem tragfähigen Kontakt kommen sollte, dass dann auch ein Therapeutenwechsel ermöglicht wird.
Die Symptome unserer Patienten werden nach auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren gemeinsam erforscht und analysiert, auf dem Boden der Bindungsbiografie verstanden und der hieraus entstehenden Persönlichkeitsstilakzentuierung und ggf. neurotischer Muster oder struktureller Einschränkungen der emotionalen Selbst- und Beziehungsregulation.
Das Symptom wird also in einen interpersonellen Kontext gestellt mit Verständnis der Funktion im aktuellen Lebensarrangement, sodass das Symptom bereits als Lösungsversuch im Rahmen der bisher gelernten Selbst- und Beziehungsregulationsfähigkeiten verstanden wird.
Daraufhin wird entwicklungsorientiert in der Therapie abgehoben auf das Erwerben von Fähigkeiten und die Aktivierung von Ressourcen und Kraftquellen der Patienten für eine bessere Selbstwirksamkeit und neue Wahlfreiheit im Umgang mit der aktuellen Problematik, sodass eine verbesserte soziale Teilhabe hierdurch ermöglicht wird.
Wir arbeiten auf dem Boden des wissenschaftlichen Konzeptes einer allgemeinen Psychotherapie von Grawe mit den Wirkfaktoren Problemklärung, -aktualisierung, -bewältigung und vor allem Ressourcen-aktivierung.
Das Beziehungserleben und das Beziehungsverhalten des Menschen steht also in der Therapie bei der Arbeit im Hier und Jetzt im Vordergrund mit der Verbesserung der Fähigkeit, über sich und andere nachdenken zu können und die eigenen Gefühle dabei zuzulassen und zu verstehen.
Hier wird auch im Sinne der Bindungsforschung auf den Aufbau einer sicheren, vertrauensvollen therapeutischen Arbeitsbeziehung mit größtmöglicher Passung und ggf. möglichem Therapeutenwechsel großen Wert gelegt im Sinne eines „sicheren Hafens“ bzw. einer ausreichenden menschlichen empathischen Unterstützung.
Neben der Problemanamnese und Defizitaufdeckung des Patienten werden von Anfang an auch die Ressourcen aktiv exploriert, um dem Patienten möglichst rasch Erfolgs- und Selbstwirksamkeitserlebnisse zu verschaffen, um hiermit das angeschlagene Selbstwertgefühl des Patienten zu verbessern.
Die psychotherapeutische Basisbehandlung depressiver Störung beinhaltet in unserem Setting folgende Aspekte:
-
Aktives, flexibles und stützendes Vorgehen,
-
Vermittlung von Ermutigung und Hoffnung,
-
empathische Kontaktaufnahme, Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung,
-
Exploration des subjektiven Krankheitsmodells, Klärung aktueller Motivation und der Therapieerwartung des Patienten,
-
Vermittlung eines Verständnisses der Symptome, ihrer Behandelbarkeit und ihrer Prognose; Vermittlung eines biopsychosozialen Krankheitsmodells zur Entlastung des Patienten von Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen und Versagensgefühlen und Förderung der Compliance;
-
Klärung aktueller äußerer Problemsituationen, Entlastung von sozial überfordernden Pflichten und Ansprüchen am Arbeitsplatz und in der familiären Situation;
-
Verhinderung depressionsbedingter Wünsche nach überstürzter Veränderung der Lebenssituation, Unterstützung beim Formulieren und Erreichen konkret erreichbarer Ziele zum Wiedergewinn von Erfolgserlebnissen („positive Verstärker“),
-
Tagesstrukturierung mit geregeltem Ruhe-/Aktivitätsrhythmus
-
Vermittlung von Einsichten in die individuelle Notwendigkeit adäquater Therapien (z. B. Antidepressiva, Wachtherapie, konfliktzentrierte oder kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierte Psychotherapie),
-
Einbezug von Angehörigen, Stärkung der Ressourcen,
-
Ansprechen von Suizidimpulsen und Erarbeitung eines Krisenmanagements mit zunehmender Erarbeitung von Selbstwirksamkeit, Selbsthilfemöglichkeit;
-
Rückfallprophylaxe (Umgang mit Erwartungsdruck und überhöhten Ansprüchen, destruktiven Beziehungsmustern, Achtsamkeits- und Akzeptanzstrategien und Aufbau von wertebasierten intrinsischen Zielen).
Als spezifische Psychotherapieverfahren werden je nach therapeutischen Vorerfahrungen und bisherigem Ansprechen und Passung entweder mehr symptomzentrierte kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze durchgeführt mit Aufbau „positiver Verstärker“, Aktivitätsaufbau, Realitätsprüfung irrationaler Überzeugungen und kognitiver Entzerrung; bei chronischer Depression/ Dysthymia werden auch neuere verhaltenstherapeutische Weiterentwicklungen wie schematherapeutische Ansätze und Situationsanalysen aus dem CBASP zur verbesserten Reflexion beziehungsgestaltender Wirkungen des eigenen Verhaltens eingesetzt. Individuell ergänzt wird dies in der Regel mit dem Erlernen von Entspannungsverfahren und hypnotherapeutischen Interventionen zur Senkung des Anspannungs-Angst-Stress-Levels, Achtsamkeitsübungen zur Distanzierung von depressiogenen Gedanken und Akzeptanz bisher unterdrückter unangenehmer Emotionen sowie Genusstraining und Aufbau adäquater Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz.
Bei eruierbaren Auslösern oder aufrechterhaltenden Faktoren für die Symptomatik im interpersonellen Umfeld des Patienten, wie z. B. Verlust- und Trennungssituationen, zwischenmenschliche Konflikte und Kränkungserleben, Rollenveränderungen, soziale Kompetenzdefizite, soziale Rückzugstendenzen mit mangelnder sozialer Einbindung und Vereinsamung, wird vorrangig der Ansatz der interpersonellen Psychotherapie, der systemischen Therapie oder der psychodynamisch orientierten Kurzzeittherapie konfliktzentriert durchgeführt.
Hier wird vor allem die Funktion und die Bedeutung der Symptomatik im Sinne eines psychosozialen Arrangements mit entsprechenden unterdrückten Botschaften und Bedürfnissen im zwischenmenschlichen Bereich zu klären und zu verstehen versucht und konkrete Lösungen im Sinne der Versprachlichung und des Ausdruckes berechtigter Wünsche und Bedürfnisse und nötiger Grenzziehungen gearbeitet.
Defizite im emotional-sozialen Kompetenzbereich werden im Sinne des emotional-sozialen Kompetenztrainings verbessert; hierfür werden dem Patienten im Rahmen der therapeutischen Gemeinschaft im Sinne von „Hausaufgaben“ erlebnisorientierte Übungsmöglichkeiten verschafft, die in der Einzeltherapie vor- und nachbearbeitet werden.
Bei unterdrückter emotionaler Wahrnehmung und eingeschränkter Ausdrucksfähigkeit wird vor allem in der Tanz- und Körpertherapie und der emotionalen Ausdruckstherapie („Tanz der Gefühle“) der Affektausdruck, die Affekttoleranz und Affektakzeptanz verbessert.
Bei Vorliegen mangelnder Emotionsregulationsfähigkeit und Impulskontrollverlusten, eingeschränkter Mentalisierungs-und Reflexionsfähigkeit, mangelnder Konflikttoleranz werden bei strukturell schwachen Patienten diese Fähigkeiten in der sog. Fähigkeitengruppe in Anlehnung an die dialektisch-behavioralen Therapie nach Marsha Linehan verbessert.
Wenn nach entsprechender therapeutischer o.g. Vorarbeit ungünstige aktuelle Beziehungsmuster die Symptomatik aufrechterhalten, werden im Sinne der Verbesserung von Partizipationsmöglichkeiten unter Bindungs-und systemtherapeutischen Gesichtspunkten auch emotionsfokussierte Familien- und Paargespräche durchgeführt unter Einbeziehung der Bezugspartner, um die eingeschränkte interpersonelle Funktionsfähigkeit gemeinsam zu verbessern oder vorliegende symptomaufrechterhaltende Konflikte zu entschärfen und um gegenseitiges besseres Verständnis zu ermöglichen.
In Rollenspielen werden sowohl in der Einzel- als auch Gruppentherapie bisher vermiedene angstauslösende zwischenmenschliche Situationen, auch am Arbeitsplatz, durchgespielt und nach neuen Lösungsalternativen im eigenen Verhalten gesucht und eingeübt.
Von Anfang an wird die Begrenzung der Therapiedauer im kurzzeittherapeutischen Setting mit dem Patienten thematisiert, um fokuszentriert zu arbeiten, zugrunde liegende Verlust- und Trennungsängste von Anfang an im Auge zu behalten und zu bearbeiten.
Gegen Ende der Therapie werden Transfermöglichkeiten in den Alltag mit dem Patienten gemeinsam in der Einzel- und Gruppentherapie erarbeitet, mögliche Schwierigkeiten antizipiert und Bewältigungsstrategien erarbeitet sowie im Rahmen der Therapiegemeinschaft den Patienten entsprechende Übungsmöglichkeiten über sog. erlebnisorientierte „Hausaufgaben“ verschafft.
Es erfolgen dann Empfehlungen für ambulant therapeutische notwendige Weiterversorgung, mit der Möglichkeit der Teilnahme an unserer Internet-Nachsorge für drei Monate, um das hier Erreichte zu stabilisieren und die Weiterversorgung durch ambulant-therapeutische Maßnahmen zu überbrücken.
Empfehlungen für ggf. notwendige stufenweise Wiedereingliederung bei langer Arbeitsunfähigkeit oder Einschränkung der Belastungsfähigkeit am Arbeitsplatz mit Empfehlungen für Arbeitsplatzumsetzungen, falls nötig, werden therapeutisch erarbeitet und dem Patienten mitgegeben.
Dr. W.-J. Maurer,
Chefarzt und ärztl. Leiter der Privatklinik,
Haus Hubertus der Panoramafachkliniken Scheidegg
Das Hörbuch zum Thema:
Bd. 8: Depression-der emotionale Infarkt:
(beinhaltet auch die „Anleitung zum Unglücklichsein“ des beliebten Vortrages von Dr. Maurer:
Wie deprimiere ich mich richtig-wie Sie sich das Leben zur Hölle machen
In diesem humorvoll-provokativem und gar nicht depressivem Vortrag erklärt der Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Dr. W.-J.Maurer, Chefarzt der Panoramaklinik in Scheidegg anschaulich aus seinem Klinik-und Praxisalltag Hintergründe, Entstehungsbedingungen und Therapiemöglichkeiten dieser häufigsten seelischen Erkrankung , die 2020 nach Prognosen der WHO den Platz der Volkskrankheit Nr1 einnehmen wird.
Und vor alle –mit einem wohlwollenden Augenzwinkern, macht er anhand seines Behandlungsalltags typische Fettnäpfchen und sich häufig automatisiert wiederholende depressiv machende Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster transparent, mit denen man sich das Leben ungewollt zur Hölle machen kann.)
Weiterführende Hörbücher:
PSS 1-5,7,8,15,21,25,27
 Wird geladen …
Wird geladen …