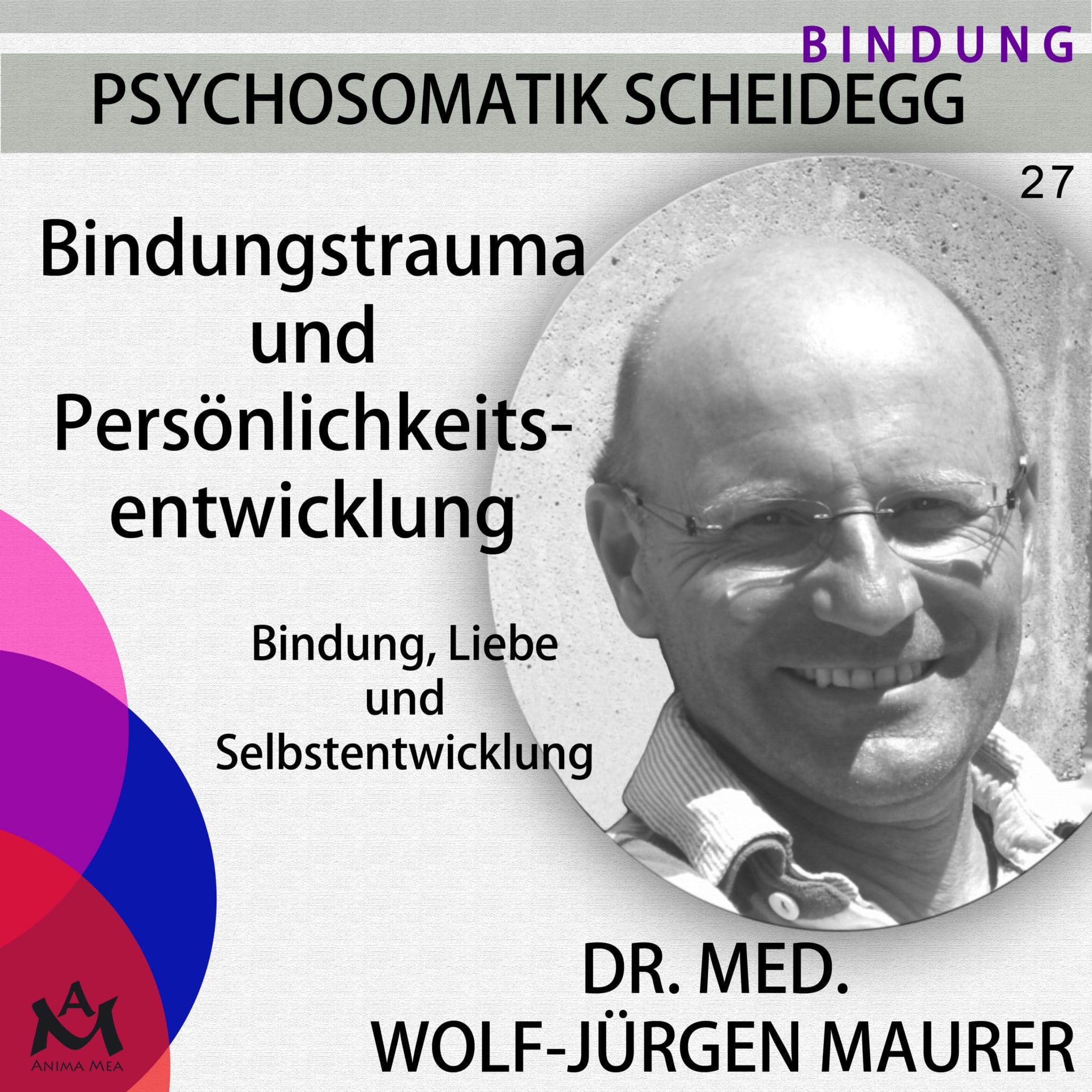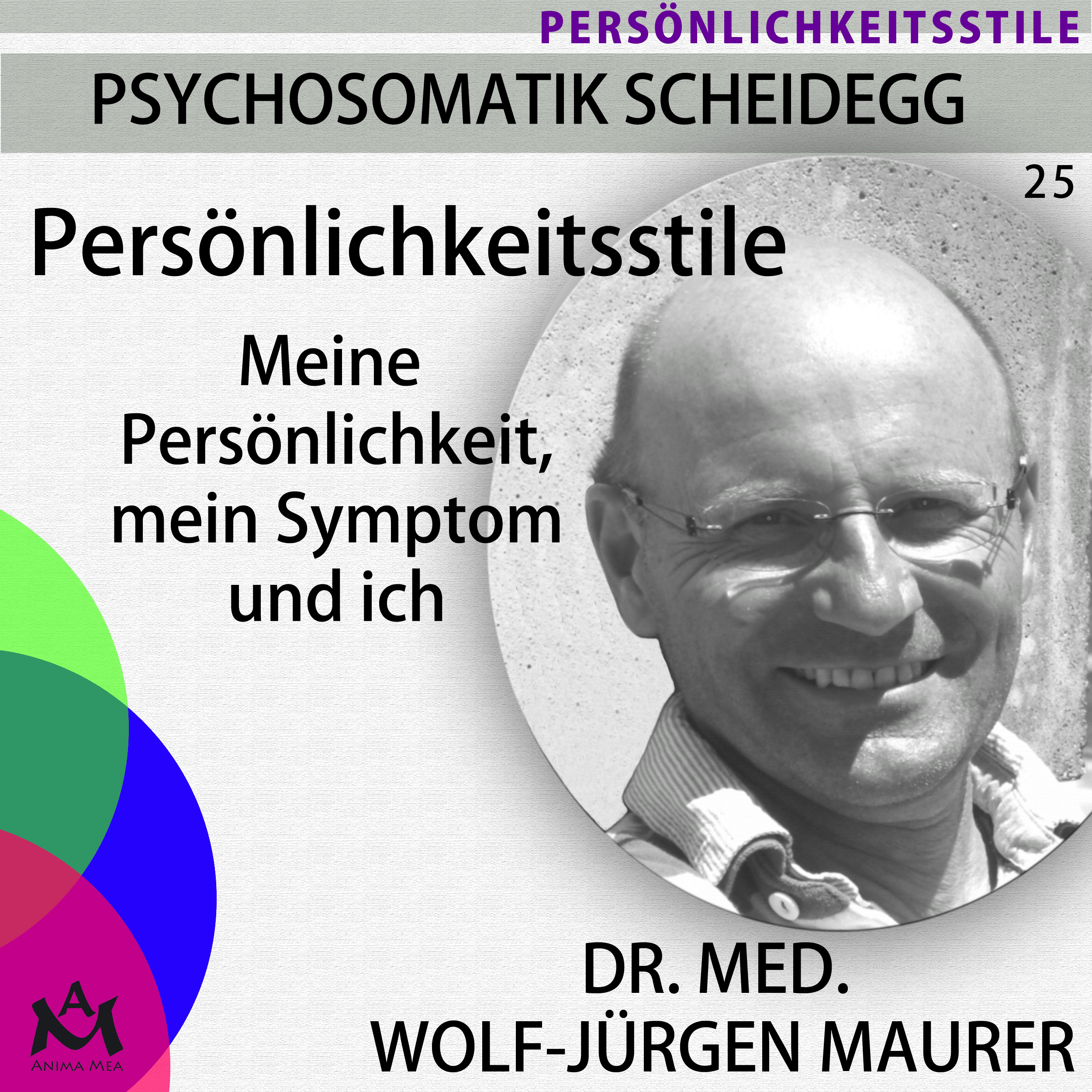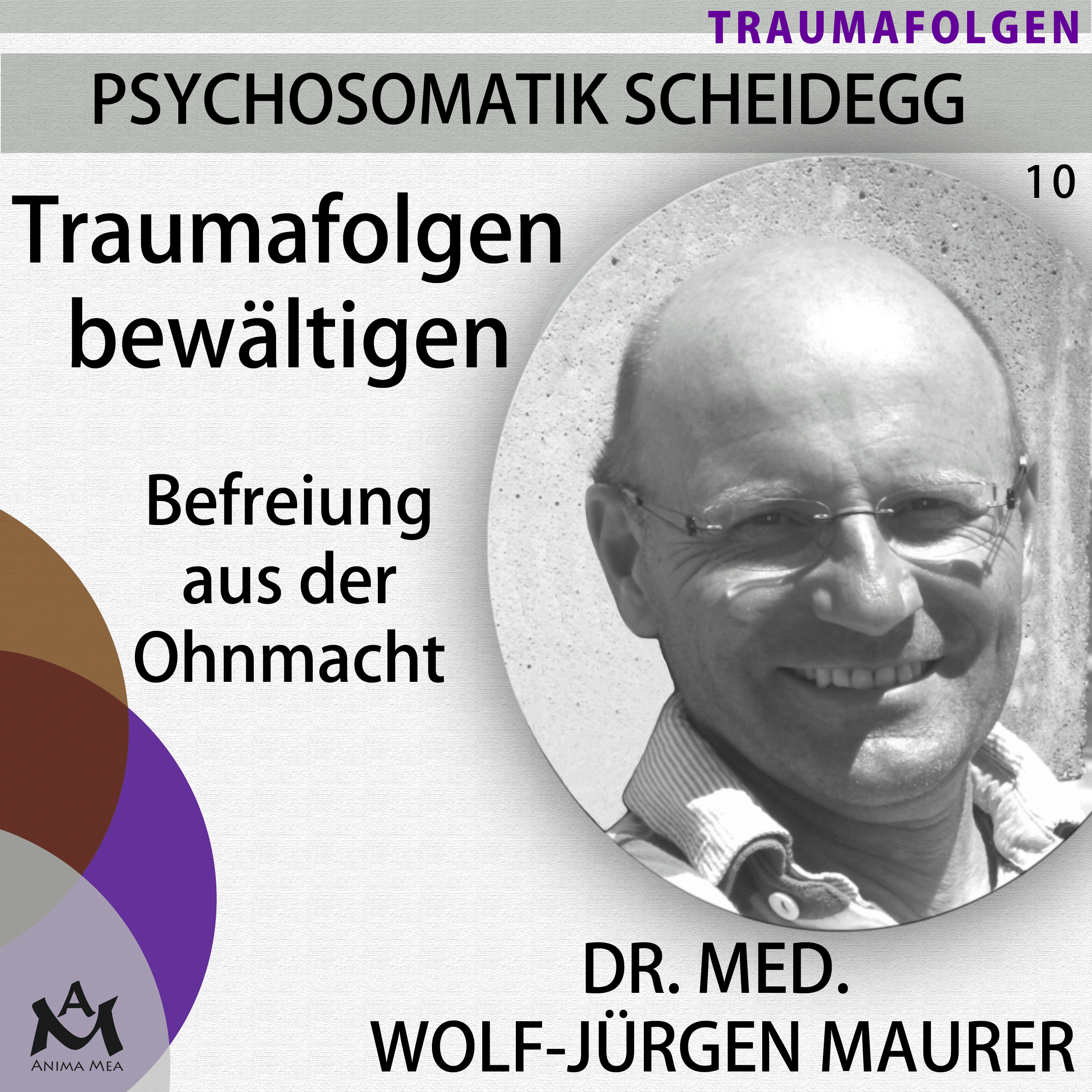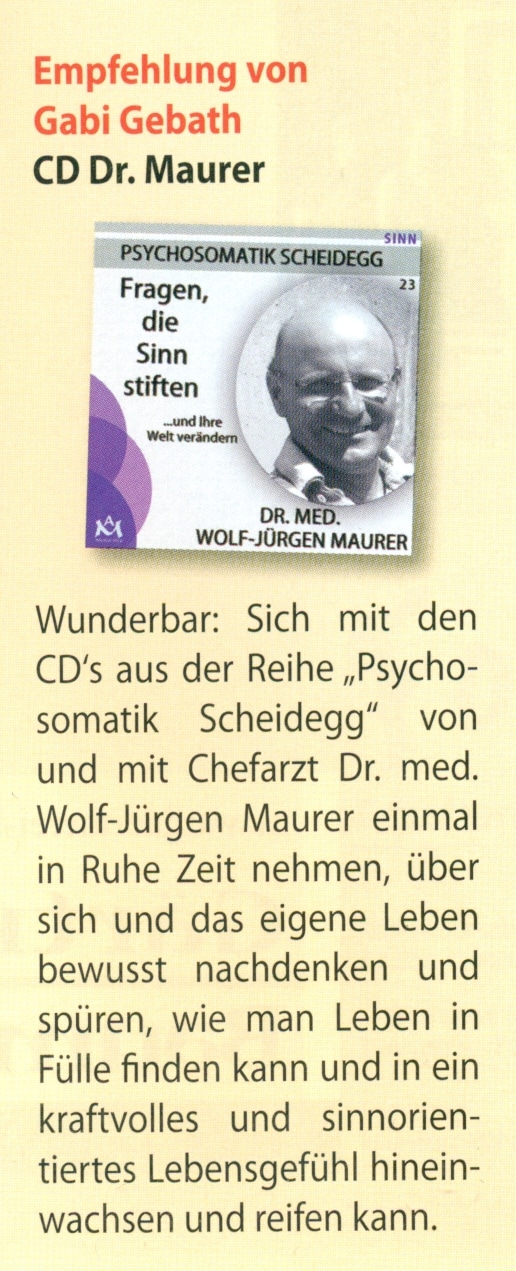Trauma und Selbststeuerung: Wie wir Folgen früher Bindungsverletzungen und kindlicher Wunden erfolgreich überwinden
von Dr. Wolf-Jürgen Maurer
Wie oft habe ich unsere Katze – manchmal etwas bewundernd und gelegentlich auch neidvoll – betrachtet.
Wie sie mit einer grandiosen lässigen Selbstverständlichkeit in sich ruht.
Und meisterhaft für sich sorgt.
Ein Musterbeispiel für gelungene Selbstregulation.
Durch sie könnte man lernen durchs Leben zu gehen ohne viel Lärm zu machen.
Elegant, selbstzentriert und voller Würde.
Aber auch liebevoll verbunden und kontaktfähig.
Mit wenigen Lauten exakt die eigenen Bedürfnisse artikulierend.
Grenzen setzend.
Nähe herstellend.
In Ruhe und Gelassenheit, doch auch ganz wach und präsent zu sein.
Wissend, dass alles seine Zeit hat und was gerade dran ist.
Sich Unterstützung holen, wo nötig, ohne sich selbst zu verraten.
Aktive maßvolle Selbstfürsorge aus einem untrüglichen Gespür für wesentliche Grundbedürfnisse.
Stressresilient und entspannungsfähig.
Und immer wieder neugierig und bis ins hohe Alter stets verliebt ins Leben.
Leichtpfötig und spielerisch sich hin zur den Sonnenseiten des Lebens bewegend.
Leider fehlen vielen meiner ansonsten so intelligenten Patienten diese für unsere Katze so selbstverständlichen Fertigkeiten einer gesunderhaltenden Selbstregulation.
Entwicklungstraumata und wie sie uns prägen: Bindung, Liebe und Selbstregulation
Die Bindungserfahrungen unserer ersten Lebensphase prägen uns Menschen ein Leben lang.
Sie haben nicht nur Auswirkungen auf unsere Persönlichkeitsentwicklung und Selbststeuerung, das spätere Beziehungsverhalten, sondern auch auf die Stressanfälligkeit – und somit auf unsere Gesundheit.
In einer modernen Psychotherapie sind problematische Beziehungsmuster und deren Veränderung zentral, damit durch anderes Beziehungsverhalten wesentliche Grundbedürfnisse des Menschen besser erfüllt werden können.
Denn die mangelnde Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse, von denen das wichtigste die Bindung ist, ist der Entstehungshintergrund von Krankheit.
Kann man in einer Therapie das Bindungsverhalten und damit die Selbstregulation klären und verbessern, steigt das Vertrauen zu sich selbst, die Fähigkeit zu verbesserter Selbstfürsorge und Selbstwahrnehmung und dann auch das Vertrauen zu anderen Menschen.
Sind diese Voraussetzungen geschaffen, kann man tragfähige und unterstützende Beziehungen aufbauen.
Neueste Forschungen der Paarinteraktion, der Hirnbiologie und der Bindungsforschung zeigen, dass auch Paarbeziehungen als eine Bindungsbeziehung zu verstehen sind und Paarprobleme als Ausdruck einer Unterbrechung der Bindungsbeziehung.
Der entscheidende Faktor für Qualität und Stabilität von Paarbeziehungen ist hierbei die emotionale Verbundenheit und Erreichbarkeit beider Partner füreinander.
Diese zu verbessern gelingt in einer emotionsfokussierten und bindungsbasierten Paartherapie.
Von der Wiege bis zur Bahre brauchen wir Menschen verlässliche emotionale Verbundenheit als sichere Basis, um uns selbst kennen, schätzen und lieben zu lernen.
Spätere psychische und psychosomatische Probleme haben in unseren frühen Bindungserfahrungen ihren Ursprung und sind Ausdruck mangelnder Selbstregulationsfähigkeit.
Stressregulation und Selbststeuerung der eigenen Emotionen gelingt bei frühen Liebesverletzungen nur schwer, weil eine frühkindliche Scham- und Verlassenheitswunde es den Menschen schwer macht, sich selbst auszuhalten, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, sich emotional zu öffnen , sich anzuvertrauen und sich lieben zu lassen und stabile gesunde Beziehungen zu halten.
Wer keine gute Beziehung zu sich selbst hat, sucht das Glück verzweifelt in äußeren leider schnell instabilen Beziehungen, die ihm das geben sollen, was er sich selbst nicht schenken kann. Aber sie können diese äußere Beziehung erst aufrechterhalten, wenn sie eine bessere innere Beziehung zu sich selbst entwickeln.
Um Hilfestellung zur heute so nötigen Selbststeuerung und Entwicklung der Liebesfähigkeit gehts im umfassendsten Werk der Anima-Mea-Reihe, in der ich Psychosomatische Medizin als Beziehungsmedizin vorstelle. Mit vielen praxisbezogenen Übungsvorschlägen zur Verbesserung von Selbstregulation, der Arbeit mit dem inneren Kind und anderen Persönlichkeitsanteilen, die sowohl für Betroffene, Angehörige als auch Behandler von Interesse sind.
Wir Menschen kommen als abhängige – hilfsbedürftige Wesen auf die Welt.
Für unsere gesunde Entwicklung und Wachstum brauchen wir von unseren Bezugspersonen Schutz, Bestätigung, Wärme und Geborgenheit, Interesse, liebevolle bedingungslose Annahme, Halt und klare Grenzen, Anleitung und Unterstützung bei der Entwicklung eigener Fähigkeiten und Interessen und Trost bei Rückschlägen und Verletzungen.
Außer Fürsorge für seine körperlichen Grundbedürfnisse braucht also jeder Mensch für sein Wachstum auch die Erfüllung existentieller psychischer Grundbedürfnisse wie sichere Bindung, Orientierung und Kontrolle, Sinnerfüllung, Selbstwerterhöhende Erfahrungen ,Autonomie und verselbständigende Entwicklung eigener Begabungen, sowie lustvolle Erlebnisse und Schutz vor unlustvollen Erfahrungen.
Dabei ist jeder kleine Mensch auf seine frühen Bezugspersonen angewiesen, die aufgrund eigener mangelhaften Selbstentwicklung und widrigen sozialen Umständen oder Krankheiten nicht selten überfordert sind.
Dann erlebt das Kind keine sichere Basis, von der aus es die Welt vertrauensvoll und zuversichtlich entdecken und sich anderen Menschen öffnen kann.
Das Ur- und Selbst-Vertrauen bildet sich nicht aus durch Verletzung der frühen Bindungsbedürfnisse bei mangelnder Hilfe zur Selbstregulation, zu der ein kleines Kind noch lange nicht fähig und existenziell von der feinfühligen Unterstützung durch seine Bindungsperson angewiesen ist.
Chronische Beziehungstraumatisierungen führen als sogenanntes Entwicklungstrauma (im Unterschied zu einem einmaligen Schocktrauma) zu Störungen der emotionalen Selbstregulierung:
Ein Kind lernt erst durch eine sichere Bindungserfahrung, durch Trost und Schutz durch die Eltern, allmählich sich selbst emotional zu beruhigen und seine Gefühle zu regulieren.
Bei unpassenden Abstimmungsprozessen insbes. in den ersten ( vorsprachlichen und oft kaum erinnerungsfähigen) Lebensjahren zw. Kind und Bezugsperson kommt es zu veränderten Stoffwechselvorgängen im Gehirn und mangelnder Entwicklung von Hirnregionen beim Kind, die für die Emotionsregulierung des späteren Erwachsenen relevant sind.
Die Menschen können später heftige Gefühle wenig tolerieren, haben eine geringe Frustrationstoleranz, können sich nur schlecht selbst wieder beruhigen und kontrollieren, haben wenig Fähigkeiten gelernt, einen inneren gedanklichen Schritt gegenüber heftigen Gefühlen zurückzutreten und das Geschehen vernünftig einzuordnen.
Sie geraten schnell in emotionale Turbulenzen und drohen davon fortgeschwemmt und überflutet zu werden, was intensive Stressreaktionen im ganzen Körper hervorrufen kann. Ängste entstehen, auseinanderzufallen, den Identitätszusammenhalt zu verlieren, vernichtet zu werden, ohne Halt ins Bodenlose zu fallen und verrückt zu werden.
Hier spielen allerdings auch genetisch-konstitutionelle Erbanlagefaktoren ebenfalls eine Rolle.
Traumatisierungen entfachen eine Traumadynamik mit neurobiologischen Hirnveränderungen:
Treten zu den Bindungstraumatisierungen noch traumatische Erfahrungen in Form von körperlicher oder sexueller Gewalt und Grenzüberschreitungen hinzu, gelingt bei geschwächten emotionsregulierenden Funktionen und ohne ein haltendes Umfeld eine Verarbeitung der meist innerfamiliären Traumata nicht.
Solche traumatisch erlebte emotionale Ausnahmezustände und Verletzungen mit dem Gefühl des hilflosen Ausgeliefertseins brennen sich dann tief ins emotionale Gehirn (Mandelkern) ein, wo sie lebenslang als „heiße“ Informationen gespeichert und leicht aktivierbar bleiben.
Eine Abspeicherung als „kalte“ sprachlich fassbare Gedächtnisinhalte (in den sog. Hippokampus, die explizite Gedächtniszentrale) wird durch den Traumastress verunmöglicht, eine Abspeicherung als vorbei und überlebt im dort und damals unterbleibt.
Durch Sinneseindrücke mit Ähnlichkeitscharakter zu der damaligen traumatischen Erfahrung werden die heißen Mandelkern-Traumaspuren getriggert, und akut und leibnah gefühlte Erlebnisfetzen in Form von Bildern (Flashback) oder Körperempfindungen, Gerüchen, Geräuschen und Gefühls-Flashbacks verwischen die Erfahrungen heute mit denen von damals und verzerren die Wahrnehmung. Außerdem führen sie zu einem anfallsweise und später stetig erhöhten Anspannungs- und Erregungszustand, der ohne mitmenschliche Unterstützung zur Selbst- Emotions-Regulation nur durch äußere Vermeidung von Trigger-Situationen und innerer Betäubung und Wegtreten (Dissoziieren) vermindert werden kann.
Als Überlebensstrategie wird der Traumakomplex versucht vom Bewusstsein abzuspalten, um weiter ein Funktionieren der sog. Alltagspersönlichkeit zu gewährleisten.
Diese Abwehrleistung verändert allerdings als Traumafolge die eigene Persönlichkeit, kostet viel Energie und schneidet den Menschen von seiner eigenen Lebendigkeit und Ganzheit ab.
Bei Ohnmachts-, Beschämungs- und Verlusterfahrungen drängen sich abgespaltene Erlebniszustände wie ungeliebte Teil-Persönlichkeiten auf und übernehmen als verletzte bedürftige „Kind-Zustände“ das Ruder der Gesamtpersönlichkeit.
Um dies zu verhindern oder zu stoppen wechseln diese Zustände häufig mit „wütend-rebellischen Zuständen“ ab, die sich als „Bodyguards oder Feuerlöscher“ zwischen die verletzlich -bedürftigen Teile der Persönlichkeit und die als Bedrohung wahrgenommene Außen-Personen drängen.
Um erneute Kritik oder Zurückweisung zu verhindern, werden auch „Täter-Anteile“ verinnerlicht in Form von „kritischen -selbstentwertenden Stimmen oder Teilen“, die zu besonderer Anpassungsanstrengung und Perfektionismus antreiben („Antreiber“) und das Äußern eigener abweichender Gefühle und Wünsche verbieten.
So führt die Notwendigkeit, als Kind die Bindungsbeziehungen zu schützen, zu Abspaltung nicht zulässiger Emotionen und Selbstanteile.
Das Kind deformiert sich selbst, nimmt Schuld und Scham auf sich selbst um seine überlebenswichtigen Bindungspersonen als „ausreichend gute Objekte“ behalten zu dürfen und sie vor gefährlicher Aggression zu schützen.
Allerdings führt dies häufig zu Auto-Aggression.
Auch selbstzerstörerische Verhaltensweisen wie selbstverletzendes Verhalten, Substanzmissbrauch, Esstörungen sowie fremddestruktive Verhaltensweisen sind als Überlebensstrategien zu werten und dienen mangels besserer Alternativen der Aufrechterhaltung der (emotionalen) Selbstregulation.
Veränderungen der inneren Erlebniswelt als intrapsychische Form der Selbstregulierung:
Die Notwendigkeit, Bindungsbeziehungen angesichts anhaltender Beziehungstraumatisierungen zu schützen, führt zu Persönlichkeitsveränderungen mit
- Entwicklung negativer Gedanken über die eigene Person und negativem Selbstbild
- einer verzerrten, wenig ganzheitlichen und unbeständigen Wahrnehmung wichtiger Bindungspersonen auch noch im Erwachsenenalter
- einer lebenslangen Aktivierung traumatischer Beziehungsmuster, die in „inneren Arbeitsmodellen von Bindung“ gespeichert sind (traumatische Bindungsmuster)
- Letztere führen nicht selten bedingt durch die Traumabiologie zu Bindung an (neue) Täter mit Retraumatisierungsneigung und Verhaftetbleiben in destruktiven Beziehungen (wiederholte Opfermuster)
- Idealisierung misshandelnder früher Bezugspersonen
- Lückenhafter Schilderung relevanter Bindungsbeziehungen und Erinnerungslücken
- Für die Selbstregulation notwendige Abwehrmechanismen wie Projektion und Verschiebung negativer Gefühlszustände auf andere Personen zur Selbstentlastung, (subtile) Manipulation anderer Menschen, bis sie sich schließlich dem projektiven Bild entsprechend verhalten, Idealisierung oder Entwertung anderer Menschen, Spaltung von Menschen und Beziehungen in ganz gut oder ganz schlecht -was als Bewältigungsversuch zu verstehen ist, Ordnung in eine bedrohlich erlebte Welt und das innere Chaos zu bringen (Schwarz-Weiß-Muster) -,Dissoziation mit Abspaltung von Gefühlszuständen und Verschiebung in den Körper als Schmerzen, Lähmung, Sinnes- oder -Empfindungsstörung oder Black-Out, Neben-Sich-Stehen, Aus-der Welt-Beamen ,erlebt wird.
Diese Reaktionen sind bei fehlenden Schutzerfahrungen als überlebensnotgedrungene Anpassung an höchst unnormale Erlebnisse und kreative Bewältigungsversuche zu verstehen und nicht als verrücktes Erleben und Verhalten.
In der späteren Behandlung sind die diversen psychischen und psychosomatischen Symptome als Ausdruck der in der kindlichen Entwicklung nicht ausreichend unterstützten und in unsicheren Bindungsbeziehungen nur mangelhaft gelernten Selbstregulation zu verstehen.
Nicht die Symptome sollten bekämpft werden, sondern Hilfen zur Co- und dann zunehmend eigenständigen emotionalen Selbstregulation müssen vermittelt werden.
Selbstregulation umfasst folgende Fähigkeiten: die Fähigkeit, sich bei emotionalem Aufruhr selbst zu beruhigen, die Fähigkeit, sich zu erholen und zu entspannen, die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auszurichten und zu halten, die Fähigkeit, Impulse zu fühlen, zu kontrollieren und gegebenenfalls zurückzustellen, die Fähigkeit, mit Frustrationen umzugehen, die Fähigkeit, Absichten zu verwirklichen und Ziele zu verfolgen, die Fähigkeit, Freude zu empfinden und die Welt erkunden zu wollen, sowie die Fähigkeit, eine Pause zwischen Reiz und Reaktion zu machen.
Bei frühen Bindungsverletzungen und Entwicklungstraumata ist die Stressphysiologie des Körpers und des vegetativen Nervensystems verändert.
Die Stresstoleranz und Schwingungsbreite des autonomen vegetativen Nervensystems ist bei jedem Menschen verschieden.
Die ideale Voraussetzung für Wohlbefinden und eine gute Stressregulation und Selbststeuerung wäre, wenn wir uns die ganze Zeit spüren und achtsamen Kontakt mit unserem Körper, unseren Gefühlen und Bedürfnissen halten würden.
Dann haut es uns nicht so schnell aus unserem Stresstoleranzfenster, v.a. wenn dies auch noch durch frühe sichere Bindungs- und emotionale Unterstützungserfahrungen recht breit angelegt ist.
Wie stark sich die Schwingungsbreite des vegetativen Nervensystems herausbildet und wie breit das Stresstoleranzfenster ist, hängt nämlich in sehr hohem Maße davon ab, wie die Geburt und die frühe Kindheit verlaufen sind.
Menschen mit einem großen Toleranzfenster können mehr Gefühle, das heißt, Erregung zulassen, ohne dass es sie stresst.
Ein Entwicklungstrauma ist der wesentliche hindernde Faktor für die Entstehung eines schwingungsfähigen, flexiblen und anpassungsfähigen Nervensystems.
Eine traumatische Reaktion entsteht immer dann, wenn der Körper keine Meldung bekommen hat, dass das überwältigende Ereignis vorüber ist und eine Normalisierung der Stressreaktion stattfinden kann. Das Lebensgefühl des betroffenen Menschen entspricht dann einer Fahrt mit der Achterbahn. Sein Nervensystem befindet sich nicht mehr oder nur noch höchst selten im Gleichgewicht, sondern schwankt von einem Zustand der Übererregung zu einem Zustand der Untererregung. Er fällt rasch nach oben oder unten aus seinem „window of tolerance“ heraus.
Geschieht etwas, das die Person in ihrer Bewältigungsfähigkeit, den sogenannten Coping-Fähigkeiten überfordert, so schlägt das sympathische Nervensystem über die Grenzen des Toleranzfensters hinaus nach oben aus. Darauf folgt eine parasympathische Überreaktion, und der Ausschlag geht nach unten über die Grenzen hinweg in die Dissoziation oder Erstarrung.
Traumafolgestörungen, Angststörungen, Depressionen, Schmerzen, Esstörungen und Suchtverhaltensweisen und die meisten anderen psychischen und psychosomatischen Störungs- und Symptombilder sind der Ausdruck einer Selbstregulationsstörung.
Das Leben fühlt sich dabei an wie ein ständiger Kampf gegen den Absturz und das Absaufen in überflutende Erregungs-,Spannungs- und Gefühlszustände.
Der Alltag ist davon geprägt, gegen Ängste, Schmerzen oder Depression anzukämpfen und einigermaßen zu „funktionieren“, was meist nur unter emotionaler Abschaltung des Gefühlskontaktes zu sich selbst gelingt.
Symptome, die auf eine sympathikotone Übererregung hinweisen sind dabei: Ständig etwas tun und in Bewegung sein, nicht zur Ruhe kommen können. Nervosität, Konzentrationsschwäche, Wutausbrüche, Schlaflosigkeit, Angespanntheit. Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Misstrauen. Vieles auf sich selbst beziehen. Arbeits- oder Sport-Sucht. Suche nach dem Adrenalin-Kick. Selbstmedikation mit allem, was beruhigt
Kann jemand einfach mal nichts tun oder muss er immer in Bewegung sein? Wie sprunghaft ist jemand in seinen Gefühlen, Gedanken und im Handeln? Wie gut spürt sich jemand in seinem/ihrem Körper? Kann er oder sie anderen Menschen vertrauen? Wie sieht es mit Hingabe, Loslassen und Entspannung aus? Kann jemand echte Intimität zulassen oder weicht er dann aus?
Ist der Parasympathikus jedoch beständig überaktiv, verwandelt sich Entspannung in Kollabieren und Ruhe in Depression.
Symptome, die auf eine parasympathische Übererregung hinweisen: Depression. Ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Sich „anders“ fühlen. In Trance gehen (zum Beispiel vor dem Fernseher oder Computer oder beim Lesen). Kraft- und Energielosigkeit. Sich allein und abgeschnitten fühlen. Sich vom Leben wie durch eine Glaswand getrennt fühlen
Fühlt sich der Mensch zugehörig? Wie viel Energie hat er? Hat er das Gefühl, falsch und von anderen Menschen getrennt zu sein? Neigt jemand zu Depression? Ist jemand chronisch müde? Fühlt sich jemand oft einsam, selbst wenn andere da sind? Fühlt sich jemand öfter wie gelähmt? Erstarrt jemand bei Stress, Konflikten, zu viel Nähe oder hohen Anforderungen? Kann jemand kaum Nein sagen und hat kein Gefühl für den eigenen Raum?
Meist schwanken die betroffenen Menschen dysreguliert beständig von einem vegetativen Überregungs-Zustand in den anderen.
Was Ihnen früh im Leben fehlte und was sie für Heilung bräuchten, ist Selbstregulation durch feinfühligen mitmenschlichen Kontakt und emotionale Unterstützung:
Menschen sind für Resonanz und Beziehung geboren. Resonanz ist immer dann gegeben, wenn wir das Gefühl haben, gesehen und gefühlt, verstanden und unterstützt zu werden.
Haben Menschen in den ersten Lebensjahren nicht genügend Resonanz und liebevolle spiegelnde Zuwendung erfahren, so entwickelt sich daraus entweder ein abhängiges Bindungsverhalten oder eine Abkehr von Bindung hin zu einer Pseudo-Autonomie. In beiden Fällen leben Menschen in einer Dysregulation, die sie im Alltag meist halbwegs kontrollieren können, um den Preis, dass sie häufig körperliche Schmerzen oder das Gefühl haben, nicht wirklich lebendig zu sein und das Leben zu genießen- und Beziehungen auf Augenhöhe führen zu können und zu wahre Begegnungen fähig zu sein.
Selbstregulation lernen wir hauptsächlich in unseren ersten drei Lebensjahren.
Die pränatalen Erfahrungen und auch der Ablauf der Geburt sind dabei ebenso wichtig wie die Bindungssicherheit und Zuwendung, die wir als Kinder erleben.
- Säuglinge werden mit einem nicht vollständig ausgebildeten Nervensystem geboren. Erst die vollständige liebevolle Hinwendung der Eltern, die sich auf ihr Kind einstellen und ihm deutlich machen, dass sie präsent sind und seine Schmerzen wahr- und ernst nehmen, ermöglichen dem Kind, seine Erregung zu regulieren mit externer Hilfe, was man in der Bindungsforschung Co-Regulation nennt. Die Fähigkeit der Eltern, sich auf Stimmungen und Bedürfnisse des Kindes feinfühlig einzustimmen und darauf spiegelnd adäquat zu reagieren, also den Geist des Kindes zu lesen, nennt man Mentalisierung (siehe auch meinen Bewusstseinstext: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann).
Durch dieses empathische Gefühlt-und Verstandenwerden und die adäquate, die kindliche Erregung regulierende Reflexionsfähigkeit der Erwachsenen mit entsprechender eingestimmter nonverbaler Kommunikation durch Mimik, Gestik, Stimme und Berührung erlebt sich das Kind seelisch-geistig und körperlich gehalten (Containment). Das Erregungsniveau wird schnell in das Toleranzfenster zurückreguliert. Dadurch entwickelt sich der kindliche präfrontale Kortex, also der Stirnhirnbereich, der als Sitz und Steuerungszentrale des Ichs, der sozialen Persönlichkeit und des Körper-Selbstes von der Hirnforschung erkannt wurde. So lernt das Kind, immer mehr selbst Erregung zu regulieren und sein Toleranzfenster erweitert sich zunehmend. Ebenso sein Empfinden von Selbstwirksamkeit und Vertrauen in sich selbst und seine Umwelt. Das Kind empfindet seinen Körper allmählich als Zuhause, als „beseelten Leib“, und entwickelt ein stabiles, facettenreiches und gut integriertes Ich, mit dem es sich identifizieren und das es als wertvoll und liebenswert empfinden kann. Und es erlernt so Selbststeuerung (und sichere Bindungsmuster mit inneren geistigen Arbeitsmodellen von hilfreich-unterstützenden und vertrauensvollen Ich-Du-Beziehungen) als die wesentliche Fähigkeit, seine Gefühle in einem breiten Spektrum zuzulassen, achtsam zu beobachten und damit zu steuern ohne von ihnen überwältigt zu werden oder abschalten zu müssen und emotional dicht zu machen – eine der wichtigsten Fertigkeiten für Stressbewältigung, adäquate Selbstfürsorge und gelingende Beziehungen sowie erfülltes Leben. Denn Leben ist Beziehung. Und erfülltes Leben besteht wesentlich aus emotionaler Verbindung und Begegnung- mit kontinuierlichem innerem und äußerem emotionalen Dialog – auf Augenhöhe.
Wenn Eltern abgelenkt, genervt oder wütend sind, also selbst dysreguliert sind und ihre Empathie und Reflexionsfähigkeit zeitweilig verloren haben, gelingt Coregulation selten. Das Kind spürt die negativen Gefühle der Bezugsperson und gerät noch mehr in Aufregung. Babys saugen wie ein Schwamm alle Gefühle in ihrer Umgebung auf und spüren diese in sich. Es kommt dabei schnell zu einem negativen gegenseitigen Hochschaukeln von Stress und Erregung. Die Eltern merken, wie gestresst ihr Kind ist, und werden noch gestresster. Im Extremfall gelingt es ihnen kaum noch, das Kind zu trösten, und sie sind resigniert und frustriert. Das Kind wiederum hat die Wahrnehmung, dass etwas Grundlegendes falsch an ihm ist. Dies wird zur Wurzel eines falschen verzerrten und negativen unbewußten Selbstbildes.
Durch lang anhaltenden Stress prägen sich das gesamte Weltbild und Selbstbild eines Menschen vollkommen anders und tiefgreifender als bei gelingender Feinabstimmung in frühen sicheren Bindungsbeziehungen.
Durch solche Entwicklungstraumata mit häufig wiederholter mangelnder feinfühliger Ab- und Einstimmung und unzureichender Stress- und emotionaler Co-Regulation werden Muster angelegt, wie wir die Welt wahrnehmen. Wer beständig in der Erwartung von Gefahr lebt, beobachtet seine Umgebung genau und nimmt diese durch eine (Kindheits-) Brille wahr, die darauf ausgerichtet ist, entsprechende „gefährliche und bedrohliche“ Signale zu entdecken. So sieht der Mensch auch als Erwachsener durch die Brille seiner kindlichen Entwicklungstraumata und er lebt auch als Erwachsener in einer feindseligen Welt der Angst und befindet sich in einem permanenten Hochstress-Alarmzustand, der unglaublich viel Energie kostet und schließlich und wiederholt in die Erschöpfung treibt. Abgetrennt von sich selbst und anderen Menschen fühlt er sich unverbunden, fragil, ohne Halt und allein.
Das durch Entwicklungstrauma entstandene Misstrauen untergräbt die Beziehungsfähigkeit und den Aufbau sozialer Kompetenzen.
So entsteht ein verzerrtes Selbst und Weltbild, das Teil der Persönlichkeit des Erwachsenen wird.
Resultierende Persönlichkeitsakzentuierungen mit unflexiblen stereotypen dysfunktionalen Denk-, Fühl und Verhaltensmustern sind Beziehungsstörungen:
Nicht nur Kontakt und Verbundenheit mit anderen, sondern auch der emotionale Bezug zu sich selbst ist dabei fragil.
Die unbewusste Abwehr von Angst und Scham formt den Charakter und der Persönlichkeitsstil soll wie ein unsichtbarer Panzer vor dem Empfinden von Verletzlichkeit und Scham und Dysregulation schützen.
Die vorgestellte Angst, als unzulängliches und nicht liebenswertes Mangel- und Mängelwesen nicht zu genügen, ist der Motor der Schutz- und Kompensationsstrategien einer neurotischen Entwicklungsstörung.
Dabei ist der Kern der Neurose der verzweifelte und erschöpfende, ja infolge eines ungesunden Perfektionismus zur Schamabwehr krankmachende Versuch, als ein anderer zu erscheinen und nicht der Mensch zu sein, der man wirklich ist.
Aber erwachsen werden bedeutet Verletzlichkeit akzeptieren, und lebendig sein, fühlen und lieben können heißt verletzlich sein.
Zu glauben, Verletzlichkeit sei Schwäche, heißt, Gefühle für etwas Defizitäres zu halten.
Indem Menschen sich aus Schamangst und Angst vor emotionaler Dysregulation gegen ihre Gefühle abschotten, zahlen sie einen zu hohen Preis und entfernen sich von sich selbst und verlieren die Verbundenheit und das, was dem Leben Sinn verleiht.
Die Scham hält klein, ängstlich und voller Groll.
Nur wenn wir mutig genug sind, unsere Schattenseiten zu untersuchen und unserer Schamwunde und unseres Schamverhaltens bewußt werden und sie benennen können, werden wir die unendlich befreiende Macht unseres Lichts entdecken.
Emotionale Offenheit braucht Mut zur Verletzlichkeit und diese ist die Geburtsstätte von Liebe, Vertrauen, Zugehörigkeit und Mitgefühl sowie von Authentizität, Freude und Kreativität.
Erst wenn wir Ungewissheit wagen, riskieren die Maske abzulegen und uns zu zeigen, können wir ein sinnerfüllendes leidenschaftliches Leben aus vollem Herzen führen.
Unser Bemühen richtet sich dann auf das was wir mit Engagement tun und welche eigene Werte wir verwirklichen wollen, und nicht darauf, wer wir in den Augen anderer sind.
Wir alle sind kostbare Kinder der Liebe und dazu erschaffen zu lieben und schöpferisch unser Leben zu gestalten.
Lieben ist allerdings eine Form von Verletzlichkeit.
Nur wer seine Scham überwindet kann endlich damit anfangen zu leben.
Wir können lernen, immer mehr zu lieben und immer weniger zu fürchten.
Wir sind nicht auf unsere frühen Bindungsprägungen als geistig offene menschliche Wesen festgelegt.
Selbstregulation ist zum Glück auch als Erwachsener noch lernbar.
Unser Gehirn und seine Verschaltungen können sich bei emotionalen Neuerfahrungen und neuer Aufmerksamkeitsfokussierung lebenslang neu verdrahten, was die Forschung als neuronale Plastizität bezeichnet.
Und wenn sich unser Gehirn ändert, ändert sich auch unsere Welt.
Dazu müssen wir allerdings wagen, uns emotionale Beziehungs-Unterstützung zu holen und die in der eigenen Entwicklung mangelhaft entwickelten Fähigkeiten zur Selbstregulation bisher vermiedener und verkapselter emotional schmerzlicher Zustände in korrigierenden heilsamen Beziehungserfahrungen zu lernen.
So integrieren wir –durch eine mentalisierungsbasierte unterstützende coregulative heilsame Bindungsbeziehung unterstützt- frühe Kindheitswunden und Pendeln dabei zwischen altem Schmerz und der heilsamen und haltenden Unterstützung der Gegenwartserfahrung achtsam hin und her (gegebenenfalls unterstützt durch schonende traumaintegrative Verfahren wie EMDR oder Klopftechniken).
Wenn diese coregulative Beziehungserfahrung verinnerlicht wird, wird der Rückgriff auf dysfunktionale selbst- und beziehungsschädliche Regulationshilfen immer weniger notwendig und die Fähigkeit zu sicheren Bindungen und die Attraktion und Auswahl entsprechend geeigneter Beziehungspartner gestärkt.
Dann wird Liebe und nicht Schmerz die Grundlage unserer Beziehungen.
Der emotionale Kontakt zum eigenen unverletzten wahren Wesen wird wieder aufgenommen, wo er einst infolge der Dysregulation abriß und der jetzt mögliche innere und äußere emotionale Dialog ist der beste selbstregulatorische Schutz vor Stress und Dysregulation und der Schlüssel zu einem erfüllenden Leben in liebevoller Verbundenheit.
Dies nenne ich ein Leben mit offenem Herzen,
und das ist es, was ich Ihnen als Ziel meiner gesamten Hörbuchreihe wirklich wünsche,
Weiterführende Hörbücher:
PSS 27, 25, 10, 14, 7, 9, 13, 20
 Wird geladen …
Wird geladen …